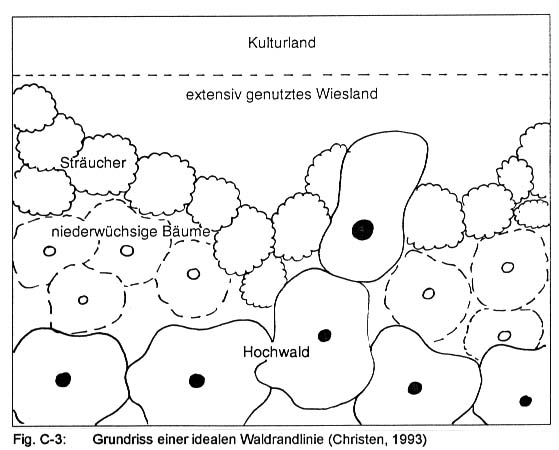
Mit der Einrichtung der NLS und entsprechender Reservatsfläche wird die Absicht verfolgt, eine nach den heutigen Kenntnissen dem Naturwald möglichst nahestehende Waldvegetation zu schaffen bzw. entstehen zu lassen. Der Mensch und sein Einfluss sollen dabei so weit als möglich in den Hintergrund treten: seine Präsenz soll nur passager, d.h. "auf Zeit" sein und keine Spuren hinterlassen. Ueberreste vergangener menschlicher Akltivitäten sind - soweit sie nicht von kulturgeschichtlichem Interesse sind - zu entfernen. Die als Zielvorlage dienende Waldvegetation im Naturzustand kann anhand der Kriterien Strukturen (vertikale und horizontale Anordnung von Bäumen und Sträuchern), Artenverteilung (vor allem der Baumarten) und der zu erwartenden Dynamik (Werden und Vergehen, Wachstum) umschrieben werden.
Die Tabelle C-1 zeigt, welche Entwicklungs-phasen einer Urwaldvegetation für die Waldungen des Sihlwaldes als richtungsweisende "Einstiegsphasen" in Frage kommen. Bei dem grossen Flächenanteil an über 60-jährigen Beständen (rund zwei Drittel) ist es gegeben mit entsprechenden Massnahmen (siehe nächstes Kapitel C-3.2) eine der Optimal- oder Plenterwaldphase vergleichbare Struktur anzustreben und eine solche als Nahziel für die überwiegende Mehrheit der in der Reservatsfläche auszuscheidenden Bestände vorzugeben. Hauptsächliches strukturelles Kriterium, ob ein Waldbestand schon "naturlandschaftswürdig" ist oder nicht, wird also das Vorkommen von Bäumen oder Sträuchern in Mittel- und Unterschicht sein. Neueste Erkenntnisse lassen den Schluss zu, weite Teile des Sihlwaldes befänden sich bereits in bester Voraussetzung für die Entlassung in eine freie Waldentwicklung. Diese Meinung vertraten auch Prof. S. Korpel (Zvolen, Slowakei) und Prof. K. Zukrigel (Wien), beides namhafte Kenner von Natur- und Urwäldern, anlässlich ihrer Besuche im Sihlwald.
Hinweise auf die wahrscheinliche Baumartenverteilung im Naturwald gibt die Tabelle C-2. Nach Waldgesellschaften gegliedert enthält sie Angaben bezüglich Hauptbaumart(en), bezüglich beigemischten Baumarten und solchen, die nur als Einzelbäume mit vorkommen. Auf rund 85 bis 90% der Waldfläche ist die Buche unbestritten die Hauptbaumart. Dies nicht nur wegen ihrer grossen Konkurrenzkraft, sondern auch weil sie in der Verjüngungsphase - neben der Weisstanne - als schattenfeste Baumart Vorteile für sich hat. Erhebliche Unsicherheit besteht darüber, wie hoch der Anteil der Weisstanne im Naturwald zu veranschlagen ist. Je dichter die Bestände und je kleinflächiger die Verjüngungen, desto grösser, kann angenommen werden, ist das Kontingent der Weisstanne. Rechnet man die Angaben der erwähnten Tabelle zu Anteilszahlen für den ganzen Wald hoch, erhält man in etwa die folgenden - hypothetischen - Baumartenanteile für den Naturwald (vgl. Tab. C-3: die erste Zahl rechntet mit einem hohen, die zweite mit einem geringen Anteil Weisstannen):
Tab. C-1: Ableitung von Strukturzielen aus Erkenntnissen der Urwaldforschung
|
Entwicklungs phasen nach Leibundgut (1982) |
Umschreibung/Charakterisierung nach Urwald-Forschung |
Vorkommen strukturähnl Bestände im Sihlwald |
Verwendung als Strukturziel in der Planung des Umwandlungsprozesses |
|
Optimalphase |
+ geschlossene starke Baumholzbestände, gute Vitalität; frühe O.: Aufsteigen aus Mittelschicht möglich; spätere O.: nicht mehr möglich |
In der Regel nur als dicht geschlossene Bestände |
Mittlere und starke Baumhölzer sind in Bestände der frühen O. zu überführen, d.h. das Kronendach ist ggf. aufzulichten, so dass eine gute Vitalität erhalten bleibt |
|
Altersphase |
Starke Baumholzbestände mit altersbedingtem Ausfall einzelner Bäume oder Trupps; wenig ausgedehnte Lücken in der Oberschicht; frühe A.: Maximalvorräte; späte Alterphase: 1/2 Maximalvorrat |
Als Folge der Bewirtschaftung nicht vorhanden |
Wird sich in einer späteren Phase, in einem Alter von 150 - 200 Jahren von selbst einstellen |
|
Zerfallsphase |
Auflösung und Zerfall starker Baumholzbestände in fortgeschrittenem Stadium; grössere Bestandeslücken und Blössen |
Nicht vorhanden |
Kann sich in einer späteren Phase von selbst einstellen, bedarf aber eines heute noch noch nicht vorhandenen Baumalters von 250-350 Jahren |
|
Verjüngungsphase |
Lockere oder lückige starke Baumholzbestände in langsamer Auflösung; reichlich Jungwuchs |
Analoge Strukturen, wenn auch für Naturwald 100-200 Jahre zu früh, vorhanden |
Die Verjüngung wird die Natur in Zukunft selbst einleiten müssen; vorgelichtete Baum- und Althölzer können - wo Baumartenzusammensetzung dem Naturzustand entspricht - sich selbst überlassen werden |
|
Plenterwaldphase |
Plenterwaldähnlich aufgebaute, stark stufige Bestände; kommen im Naturzustand vor allem in steilen Gebirgslagen, im Laufe der Optimalphase aber auch auf anderen Standorten vor |
Hauptsächlich auf Steilhängen und Tobelflanken; erste Ansätze in anderen Lagen als Folge entsprechender Eingriffe |
Infolge der bestehenden Bestandesstrukturen (Vorherrschen von Baum- und Althölzern) wird P. eine mög liche "Einstiegsphase" sein; ob sich die ästhetisch schönen und für Erholungszwecke speziell geeigneten P. über längere Zeiträume werden hal ten können, wird erst die Entwicklung zu Naturwald zeigen |
|
Phase des gleichförmigen starken Stangen- und Baumholzes |
Aus grossflächigen Verjüngungen entstanden; Holzvorräte erheblich geringer als in Optimalphase; meist noch intensives Höhenwachstum |
Als Folge der grossflächigen Abtriebe stark vertreten |
In der waldbaulichen Planung nicht als Strukturziel verwendet, da im Raum des Sihlwaldes kaum naturgemäss |
Tab. C-2: Waldgesellschaften und Baumartenanteile im Naturwald
(nach Grundlagenstudie "Vegetation" und Vegetationskundliche Kartierung
der Wälder im Kanton Zürich, BGU 1988, sowie ELLENBERG/KLöTZLI:
Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz, 1972)
|
Haupteigenschaft Waldboden |
Waldgesellschaften, Standorte |
Flächenanteile im Sihlwald |
Hauptbaumarte(n) |
stellenweise dominierende B. |
einzeln beigemischte B'arten |
|
|
saure Waldböden |
Saure Buchenwälder (1, 2, 6, 8*): trockene, relativ saure Böden, oft Kuppenlagen; häufig Rohhumusauflage |
1% |
Buche |
Hbu |
Fö Ta |
|
|
mittlere Waldböden |
Waldmeister-Buchenwald (7): mittlere, gut nährstoff- und wasserversorgte Braunerden der kollinen und sub- montanen Stufe |
19% |
Buche |
Hbu Es Bah Ta |
Fi Ki |
|
|
50% |
||||||
|
Waldhirsen-Buchenwald (8): mittlere, gut nährstoff- und wasserversorgte Braunerden der unteren Montanstufe |
31% |
Buche (Fichte) |
Ta |
Bah Es |
||
|
kalkhaltige Waldböden |
Lungenkraut-Buchenwald (9): frisch- feuchte, kalkreiche Rendzinen oder Braunerden der kollinen und sub- montanen Stufe |
1% |
Buche |
Es |
Ta Bah Ki |
|
|
Aronstab-Buchenwald (11): feuchte, ton-, basen- (oft kalk-) und nähr- stoffreiche Braunerden auf Hängen und Hangfusslagen der kollinen und submontanen Stufe |
8% |
Buche |
Es |
Bah Ta Sah Bul |
||
|
27% |
||||||
|
Zahnwurz-Buchenwald (12): frisch- feuchte, skelettreiche, lockere Kalkböden der submontanen oder montanen Stufe |
18% |
Buche |
Ta |
Es Bah Eibe |
||
|
vernässte bis über- schwemmte Böden |
Ahorn-Eschenwald (26): nährstoffreiche, neutrale, im Unterboden vernässte Hangfusslagen der kollinen, submon- tanen und montanen Stufe |
3% |
Esche |
Bah |
Bul Ser Wli Ta |
|
|
Seggen-Bacheschenwald (27): kalkreich- humose Hangquellsümpfe der submontanen und montanen Stufe |
6% |
Esche |
Ser |
Bah |
||
|
9% |
||||||
|
Traubenkirschen-Eschenwald (30): manchmal überschwemmte, staunasse Mulden der kollinen und submontanen Stufe |
-% |
Esche |
Ser |
Ta |
||
|
Seggen-Schwarzerlenbruchwald (44): oft überschwemmte Mulden der kollinen und submontanen Stufe |
-% |
Schwarz- erle |
||||
|
wechsel- hafte Boden- feuchtig- keit |
Wechselfeuchte bis wechselnasse Buchen- wälder (10w, 12w, 14w, 15w, 17): merge- lige Hangstandorte mit wechselhaftem Wasserregime; kolline, submontane bis montane Stufe |
12% |
Buche |
Es Bah Ta |
Ki Bah Fö Eibe |
|
|
13% |
||||||
|
Pfeifengras- und Orchideen-Föhren- wälder (61, 62): Mergelböden mit stark wechselnden Wasserverhältnissen auf steilen, oft erosionsanfälligen Hängen; submontane bis montane Stufe |
1% |
Föhre Mehl- beere |
Eibe |
Bah Bu |
||
Baumarten: Bah = Bergahorn Bul = Bergulme Es = Esche Fi = Fichte/Rottanne Fö = Waldföhre
Hbu = Hagebuche Ki = Kirschbaum Sah = Spritzahorn Ser = Schwarzerle
Ta = Weisstanne
|
Baumart Anteil bei |
|
|
|
|
viel Weisstanne |
wenig Weisstanne |
|
Buche |
45% |
60% |
|
Esche |
10% |
15% |
|
Bergahorn |
5% |
5% |
|
Weisstanne |
35% |
15% |
|
diverse |
5% |
5% |
Tab. C-3: Baumartenanteile für den Sihlwald, hochgerechnet aus den Angaben von Tab. C-2
Die heutige Baumartenverteilung zeigt - als Folge der Bewirtschaftung - ein recht anderes Bild: Buche und vor allem Weisstanne sind untervertreten, die Fichte viel zu häufig und nur Esche, Bergahorn sowie die übrigen Baumarten sind in einem Anteil vorhanden, wie er dem Naturwald entsprechen würde. Massgebend als Zielvorgaben für die Baumartenmischung sind aber nicht deren Anteile auf der Gesamtwaldfläche, sondern stets der Einzelfall, d.h. der Bestand und seine Zuordnung zu einer der natürlichen Waldgesellschaften, wie sie die erwähnte Tabelle wiedergibt. Allen Laubbaumarten sowie der Weisstanne, der Föhre und der Eibe ist ein grösstmöglicher Spielraum zuzugestehen. Die eigentlichen "Problembaumarten" sind die Fichte und - in geringerem Masse - die Lärche. Sie passen schlecht ins Bild des Naturwaldes, sei es wegen ihres Vorkommens überhaupt, wie im Falle der Lärche, sei es wegen ihres grossen Anteils, wie im Falle der Fichte (in höheren Lagen hat die Fichte als postglaziales Relikt ein beschränktes natürliches Verbreitungsgebiet). Die Anteile dieser beiden Baumarten sind vor Einrichtung der Reservatsfläche zugunsten natürlich aufkommender Baumarten drastisch zu reduzieren.
In einem Naturwald soll eine absolut ungelenkte Dynamik wirken können. Sie wird sich von der flächigen, oft schematischen Generationenfolge, wie sie bis heute auch im Sihlwald zu finden ist, abheben. Wo nicht natürliche Ereignisse oder Einwirkungen auf grosser Fläche Jungwald entstehen lassen, werden im Sihlwald voraussichtlich dauernd ungleichaltrige Bestände stocken, auch wenn sie vorübergehend die Vor-Optimalphase der gleichförmigen, geschlossenen Baumhölzer durchlaufen. Wegen der im Naturwald zu erwartenden ungleich längeren Lebensdauer der Baumindividuen wird es gesamthaft zu weniger auffällig-dynamischen Vorgängen kommen als vergleichsweise in einem Wirtschaftswald. Wer sich Dynamik im Naturwald besehen will, muss seine Aufmerksamkeit deshalb auf kleinformatige Vorgänge wie Leben auf umgestürzten Bäumen, Aufwuchs in Bestandeslücken, Vorgänge in alternden Bäumen richten oder das Mosaik von gleichzeitig nebeneinander bestehenden Stadien als dauernden Prozess erfassen.
Das waldbauliche Ziel ist letztlich weder ein bestimmter Waldzustand noch diese oder jene Bestandesstruktur, sondern die langsam und stetig voranschreitende Walddynamik, wie sie sich aus dem Wechselspiel von natürlicher Umgebung und natürlicher Waldvegetation ergibt. Als Menschen (und insbesondere als forstliche Planer) müssen wir uns damit abfinden, dass wir im Sihlwald ein Ziel setzen, das wir nicht kennen und über das - sowie über die Wege, die dazu hinführen - wir aufgrund unseres beschränkten Wissens nur Vermutungen anstellen können.
Im Laufe der Vorarbeiten zum Projekt NLS wurden zahlreiche Gespräche mit Experten und Diskussionen darüber geführt, ob die Rückführung des Wirtschaftswaldes durch aktive waldbauliche Massnahmen einzuleiten und zu beschleunigen sei, oder ob man grundsätzlich auf jede Einflussnahme verzichten soll. Wahrscheinlich gibt es ebensoviele Meinungen wie Experten. Die wichtigsten Argumente dafür und dagegen sollen deshalb kurz zusammengefasst werden.
Gegen
die Ergreifung von aktiven, waldbaulichen Massnahmen spricht:- Man kann heute nicht mit Sicherheit wissen, welche Bäume für einen Naturwald wichtig sein werden und welche sich organisch in das zukünftige Bestandesgefüge einzuordnen vermögen.
- In 200 Jahren wird man ohnehin nur schwer einen Unterschied erkennen können zwischen jetzt behandelten oder unbehandelten Waldbeständen.
- Die Natur bewerkstelligt die Rückführung besser und authentischer.
- Ueber Struktur und Artenzusammensetzung im Naturwald können wir nur Hypothesen aufstellen, die wir aus den Analysen von Urwäldern auf doch recht andersartigen Standorten ableiten.
- Faktisch ist der Sihlwald bereits in weiten Teilen in einem fast optimalen Zustand für die Entlassung in die freie Waldentwicklung.
Für
die gezielte Vorbereitung der Waldbestände kann ins Feld geführt werden:- Erkenntnisse aus Urwaldforschung, Pflanzensoziologie und forstlichem Alltag zeigen, welche Eingriffsarten zu naturwaldähnlichen Entwicklungen führen.
- Noch sind - auch im Sihlwald - viele naturfremde Relikte der früheren Bewirtschaftung auszumachen; sie sollten zumindest teilweise beseitigt werden.
- Unsere schnellebige Zeit möchte wenigstens in mittelfristigen Zeiträumen Resultate der Rückführung sehen, auf die man sonst über Generationen hinweg warten müsste.
- Bezüglich der Baumartenverteilung sind wenigstens die krassesten "Fehlbesetzungen" zu korrigieren.
- Die aktive - u.U. unnötige, aber nicht kontraproduktive - Rückführung erlaubt, bestehende Betriebskapazitäten während einer Ubergangszeit zu beschäftigen.
Aus dieser Gegenüberstellung können folgende Schlüsse gezogen werden:
- Sofern die geplanten Massnahmen mit genügender Sicherheit nicht vom Ziel wegführen, steht ihnen nichts entgegen; bis vor kurzem wurde ohnehin fast auf der ganzen Waldfläche Waldbau betrieben, so dass diese "letzten" Eingriffe - auch wenn sie wenig nützen sollten - nichts zerstören, was schon auf dem Weg der Rückführung entstanden wäre.
- Im Sinne einer Konzession an die Erwartungen einer breiteren Oeffentlichkeit würde eine allzu dogmatische Haltung in dieser Farge - d.h. ein strikter Verzicht auf alle menschengelenkten Massnahmen - vorerst noch kaum verstanden werden.
Zur Verbesserung von Struktur und Baumartenzusammensetzung sind - wo nötig - in den jeweiligen Entwicklungsstufen die nachstehenden Massnahmen vorzusehen:
|
Entwicklungs- stufe |
Korrekturmassnahmen bezüglich Struktur |
Baumartenanteile |
|
Jungwald bis starkes Stangenholz |
Kleinflächige, mosaik artige und einzelgruppenweise Differenzierung des Alters; Dichtstand klein flächig zulassen |
Bevorzugung der Baumarten des Naturwaldes; zur Mosaikbildung abwechselnd Weichhölzer und Klimaxbaumarten fördern |
|
Starkes Baumholz bis Altholz |
Sehr zurückhaltende Vitalitätsförderung; Auflösung der Aspekte des Altersklassenwaldes; Unterstützung der Entwicklung extrem hoher Baumalter, d.h. Vermeidung von Verletzungen (auch im Wurzelbereich), gute Kronenausformung |
Entfernen standortsfremder Baumarten |
Tab. C-4: Korrekturmassnahmen bezüglich Struktur- und Baumartenanteil
Grundsätzlich ist der Strukturentwicklung mehr Gewicht beizumessen als der Regulierung der Baumartenanteile.
Eine Hypothek für die Rückentwicklung zu Naturwald ist das ungenügende Aufkommen von Weisstannen-Anflug und Eibenverjüngung als Folge des teilweise übersetzten Rehbestandes. Wegen der Abäsung dieser schattenertragenden Nadelbäume muss angenommen werden, dass die Rückführung in Naturwald zwei wichtiger Komponenten - der Ausbildung von stufigem Nebenbestand sowie des Nachwuchses von zukunftsträchtigen Weisstannen - beraubt ist.
Eigentliche Verjüngungsschläge sind im gesamten Gebiet des Sihlwaldes keine mehr anzulegen. Statt dessen können unbefriedigende Waldbestände (z.B. Fichtenreinbestände), soweit sie durch aufbauende Eingriffe nicht zu "retten" sind, destabilisiert, d.h. ihr Bestandesgefüge so weit geschwächt werden, dass sich kleinflächig Jungwald einstellt oder der Hauptbestand in möglichst unregelmässiger Art und Weise über einen längeren Zeitraum hinweg zusammenbricht. Daraus werden sich in der Folge auf natürlichem Wege neue Bestände herausbilden. Standortsgemässe Baumarten wie Buche, Esche, Bergahorn oder Weisstanne verjüngen sich im ganzen Sihlwaldgebiet so intensiv, dass auf Pflanzungen oder Saaten verzichtet werden kann.
Waldbauliche oder kulturgeschichtliche Relikte wie z.B. die Durchforstungs-Versuchsflächen von ETH und WSL oder die Fichten- Föhren-Lärchen-Bestände in der Abt.27 (siehe Kapitel B-3.4) sind so lange als möglich zu bewahren.
Wo die Ziele der Bestandesstrukturen und der Baumartenverteilung erreicht sind, steht - sofern nicht auf andere Aufgaben oder Nutzungen Rücksicht zu nehmen ist - der Entlassung in eine Reservatsfläche nichts entgegen.
Die Einrichtung eines Naturwaldes bzw. die Rückführung dahin braucht andere Modelle, an denen der Erfolg der Bemühungen gemessen werden kann, als die im Wirtschaftswald üblichen. Nicht die nachhaltige Nutzung, der Aufbau der Sortimente oder die Bestimmung erntereifer Bestände steht im Vordergrund, sondern Fragen wie:
- Haben wir uns dem Naturwaldzustand genähert?
- Ist die Struktur, die Baumartenzusammensetzung natürlicher geworden?
- Haben die getroffenen Massnahmen die erwartete Wirkung erbracht?
- Wo hat der Wald welche Eigendynamik entwickelt?
3.3.1 Einrichtungstechnische Parameter
Eine eindeutig definier- und erkennbare Urwaldstruktur, die als Modell dienen könnte, gibt es allerdings nicht. Annäherungen können einerseits aufgrund von Aufnahmen in Tannen-Buchen-Urwäldern der Bergstufe in Jugoslawien und der Tschechoslowakei gefunden werden (LEIBUNDGUT 1982). Erfahrungen mit Buchen-Hallenbeständen in Tieflagen andererseits, die 1750-1850 in der Optimalphase gestanden haben und in denen die Altersphase um 1850 einsetzte, wurden im Forstamt Lüttenhagen (Bundesland Mecklenburg-Vorpommern) gesammelt: die "Heiligen Hallen", ein 25 ha grosser Perlgras-Buchenwald (vergleichbar unseren Hainsimsen-Buchenwäldern auf sauren Böden), werden seit annähernd 150 Jahren nicht mehr genutzt. In den 50er Jahren unseres Jahrhunderts hat in den heute 350-jährigen Beständen die Zerfalls- und Verjüngungsphase eingesetz.
Anhand dieser Quellen kennzeichnen (Buchen-)Naturwälder folgende gemeinsamen einrichtungstechnischen Merklmale:
- Flächenanteile der Entwicklungsphasen: In überalten Buchenbeständen (250 - 350 Jahre) erfolgt der Zusammenbruch und damit auch die Verjüngung meist nur kleinflächig. Ein grosser Teil der Fläche wird von stark ungleichaltrigen, jedoch gleichförmigen, vorratsreichen, ziemlich einschichtigen Beständen der späten Optimal- und vor allem der Altersphase eingenommen. Bei einem hohen Buchen-Anteil bilden sich in den Optimal- und Altersphasen hallenartige Bestände heraus (diese Erfahrung wurde in den "Heiligen Hallen" gemacht; es wäre forstgeschichtlich abzuklären, ob nicht landwirtschaftliche Nutzungen aus früheren Jahrhunderten den dortigen Waldzustand mit prägen; im vergleichsweise üppigen Sihlwald darf aufjedenfall - vor allem wenn Weisstanne und Eibe Gelegenheit zum Aufkommen haben - mehr Unterwuchs, Stufigkeit und Nebenbestand erwartet werden).
- Baumzahlen: Aussergewöhnlich niederig sind die Stammzahlen im Jungwald, in Dickungen z.B. statt 100'000 und mehr wie im Wirtschaftswald nur gerade 2'000 Bäume pro ha. In den übrigen Phasen sind die Zahlen der Bäume pro Hektare örtlich stark verschieden, in der Plenterphase in der Regel etwas höher, d.h. bis gegen 400 Bäume pro ha. Die Tannen-Buchen-Urwälder weisen auf ihrer Gesamtfläche alle überhaupt denkbaren Strukturen und Stammzahlverteilungen auf. In Beständen der "Heiligen Hallen" verringerte sich die Stammzahl von 240 in der Optimalphase auf 150 Bäume pro ha in der Terminalphase (Altersphase). (Im Sihlwald stehen im Vergleich noch über 400 Bäume auf jeder Hektare).
- Baumhöhen: Einzelne Bäume erreichen - als Folge der späten Kulmination des Höhen- und Durchmesserzuwachses - beeindruckende Gesamthöhen: sie altern langsam, das Wachstum hält lange Zeit an. Für die Buchen wurden auf guten Standorten bis 55 m, in den "Heiligen Hallen" annähernd 50 m gemessen. (Im Sihlwald sind Bestände mit einer Oberhöhe von 45m und mehr registriert worden; der mächtigste Baum hatte eine Länge von 48m).
- Baumartenmischung: Besonders gross ist der Buchenanteil in der Plenterwaldphase, während in der Alters- und Zerfallsphase ihr Anteil, wegen der geringeren Lebenserwartung, zurückgeht und an ihre Stelle meist die Weisstanne tritt. Die Mischungsverhältnisse variieren stark, je nach dem ob z.B. eine Optimalphase aus einem grossflächigen Jungwald, aus einer Plenterwaldphase oder aus einer während langer Zeit überschirmten Unterschicht entstanden ist. Die Baumartenmischung ist selbstverständlich stark vom Standort geprägt.
- Kreisflächen: Alle untersuchten Urwälder zeigen sowohl im Durchschnitt wie vor allem auch in den Optimal- und Altersphasen grosse Kreisflächen pro ha: sie schwanken zwischen 40 bis 80, ausnahmsweise gar 90 m2. Am grössten ist die Kreisfläche in der Optimal- und Altersphase, etwas geringer in der Plenterwaldphase und nur halb so gross in der Zerfalls- und Verjüngungsphase. (Im Sihlwald wies die Probefläche mit der grössten Basalfläche 73 m2 auf; der Durchschnitt dürfte etwa bei 27 m2 liegen).
- Holzvorrat: Die grössten Holzvorräte findet man in der Optimal- und Altersphase, wo in Tannen-Buchen-Urwäldern - entsprechend der grossen Kreisflächen - bis maximal 1'400 m3/ha, in Plenter-waldphasen entsprechend weniger (700 bis 1'000 m3) stehen kön-nen. Der grösste Teil der Vorräte entfällt auf die Oberschicht, in Buchenbeständen der Optimal- und Altersphase gar bis 97%. (Der grösste Hektarvorrat im Sihlwald betrug 1990 auf einer einzelnen Probefläche 1146 m3, im Durchschnitt 331 m3).
- Stärkeklassen: Einen besonders hohen Anteil von über 90% Starkholz (52 cm Durchmesser und mehr) zeigen in Tannen-Buchen-Urwäldern die Optimal- und Altersphasen, während in Beständen der Plenterwaldphase die Holzmasse im wesentlichen auf die Klassen III (36-52 cm) und IV (über 52 cm) und in geringerem Masse auf die Klasse II (24-36 cm) verteilt ist. (Bei den Aufnahmen 1990 wurden im Altholz Starkholzanteile von bis zu 57% erhoben; der Durchschnitt lag bei 32%).
- Totholz: entsteht einerseits als Wirkung der Konkurrenz, andererseits als Folge natürlicher, altersbedingter Ausscheidung. In der Plenterwaldphase sind es vor allem schwache Bäume (8 bis 16 cm), die dürr werden, in der Optimalphase die mittleren Durchmesser und in der Altersphase vorwiegend starke Bäume, namentlich Buchen (unterschiedliche Lebenserwartung: Tanne 600 und mehr Jahre, Fichte bis 600 Jahre, Buche meist nicht über 400 Jahre). Die Masse der toten Bäume schwankt deshalb in einem sehr breiten Bereich (nach LEIBUNDGUT 1972):
|
Entwicklungsphase |
tote Bäume |
|
|
Holzmasse % |
Vorrat m3/ha |
|
|
Plenterwald |
10-15 |
130-140 |
|
Optimalphase |
15-20 |
170-180 |
|
Alters-/Zerfallsph. |
> 25 |
340-350 |
Tab. C-5: Totholzanteile nach Leibundgut, 1972
Der Anteil Totholz und sein Gesamtvolumen können u.U. als Unterscheidungsmerkmal der Entwicklungsphasen herangezogen werden. (Ueber den Totholzanteil im Sihlwald liegen aus dem Jahr 1990 keine Angaben vor).
- Zuwachs: Urwaldbestände weisen eine überraschend lang andauernde Zuwachsleistung auf. Ein Stillstand, wo sich Zuwachs und absterbendes Holz die Waage halten, tritt erst in der Altersphase auf, und Zuwachsrückgänge sind in der Regel nicht früher als in der Zerfallsphase festzustellen. Dies erklärt sich dadurch, dass vorerst, bei einsetzenden altersbedingten Abgängen, der Ausfall durch freigestellte, vitale Bäume der Mittelschicht wettgemacht wird. Zuwachs und Entwicklungsphasen verhalten sich zueinander also wie folgt (nach LEIBUNDGUT 1972):
- Plenterwald- und Optimalphase: Zuwachs Abgang
- Altersphase/Terminalphase: Zuwachs = Abgang
- Zerfallsphase/Verjüngungsphase: Zuwachs < Abgang
Anhand der Bestimmung des Zuwachses können Auswerteeinheiten bestimmten Entwicklungsphasen zugeordnet werden. Letzlich wird aber, über die ganze Waldfläche und über längere Zeiträume gerechnet, das abgehende Holz durch die Zuwächse vollauf kompensiert, d.h. der Holzvorrat hält sich und fluktuiert lediglich in einem mehr oder weniger schmalen Band.
In der Tabelle C-6 sind die ertragskundlichen Kriterien und ihre Bedeutung für eine Beurteilung von Naturnähe und damit Erfolg der Rückführung zu Naturwald dargestellt. Am meisten diesbezügliche Informationen sind demnach aus einer direkten Ansprache der Entwicklungsphase, aus der Baumartenmischung, aus dem Stärkeklassenaufbau, aus den maximalen Baumhöhen und aus dem Totholzanteil herauszulesen. Auf lange Sicht hinaus sind aus Stammgrundfläche, Holzvorrat und Totholzanteil indirekt Bestätigungen darüber zu erhalten, ob gewisse Eigenschaften wie grössere Holzvorräte oder hohe Anteile an totem Holz, die Naturwäldern eigen sind, erreicht worden sind. Totholzanteil, Stärkeklassenaufbau und Zuwachsleistung werden schliesslich dereinst, nach Erreichen einer naturwaldähnlichen Struktur, darüber Aufschluss geben, welcher Entwicklungsphase ein Bestand oder eine Auswerteeinheit zuzuordnen ist.
Hinweise, wie weit die Naturwaldziele heute schon erreicht sind, können bereits jetzt den Bestandesaufnahmen 1990 entnommen werden. So war aufgrund einheitlicher Kriterien die Frage zu beantworten, ob die jeweiligen Bestände sofort, erst nach der nächsten Planungsperiode oder zu einem späteren Zeitpunkt in eine Reservatsfläche zu entlassen sind. Aus all diesen Daten können Rückschlüsse auf den Waldzustand und - nach Verbesserung der Beurteilungskriterien sowie Wiederholungen in 10, 20 und mehr Jahren (vgl. Kapitel DIII-8.2) - auf die Rückentwicklung zu Naturwald gezogen werden.
Veränderungen am Waldzustand werden mit grosser Detailtreue, aber nur auf äusserst beschränkter Fläche - vorläufig auf 22 Aren - durch die Waldprofile festgehalten (siehe Kapitel B-3.1). Die Aufnahme der Profilstreifen sollte periodisch wiederholt werden.
Tab. C-6 Eignung ertragskundlicher Parameter für NLS Projekt
|
Parameter |
Eignung als Beurteilungsmassstab für Rückführung |
Berücksichtigung in Aufnahmen 1990 |
Bedeutung für Folgeaufnahmen |
|
Entwicklungsphasen |
Direkte Ansprache der Entwicklungsphasen gut geeignet |
Ausscheidung E. nicht erfolgt, da noch keine Differenzierung in E. |
Ansprache E. in einigen Jahrzehnten möglich |
|
Stammzahl |
Kaum geeignet |
Aufgenommen p. Auswerteeinheit, Baumart, Revier, Gesamtwald |
Nicht von Bedeutung |
|
Baumhöhen |
Geeignet: in Naturwäldern können Einzelbäume enorme Höhen erreichen |
Aufgenommen für Tarifbäume; keine Auswertung ausser für Tarif |
Maximale Baumhöhen werden Hinweise geben auf ungestörte Entwicklung |
|
Baumartenmischung |
Geeignet als Hinweis für Erfolg der Rückführung zu Naturwald |
Inventurdaten p. Auswerteeinheit, Revier, Gesamtwald; okulare Taxation in Bestandesbeschreibung/Bestandeskarte |
Wird weiterhin wertvolle Hinweise auf Erfolg Rückführung, aber auch auf natürliche Weiterentwicklung geben |
|
Stammgrundfläche (Kreisfläche) |
Ueber sehr lange Zeiträume hinweg geeignet als Hinweis auf erfolgreiche Rückführung |
Aufgenommen p. PBF, aber nicht weiter ausgewertet |
Könnte als Kennziffer für Entwicklungsphasen ausgewertet werden |
|
Holzvorrat |
Es gilt Aehnliches wie für Stammgrundfläche |
Ausgewertet f. PBF, Auswerteeinheit, Baumart, Revier, Gesamtwald |
Soll auch in weiteren Inventuren aufgenommen und ausgewertet werden |
|
Stärkeklassen |
Gibt Hinweis auf Bestandesstruktur; geeignet zur Definition von Entwicklungsphasen |
Ausgewertet p. Auswerteeinheit, Revier, Gesamtwald; leider keine bestandesweise Angaben |
Von Bedeutung, sofern Auswertung mit Ansprache von Entwicklungsphasen gekoppelt würde |
|
Totholz |
Ergibt Hinweis auf Erfolg Rückführung und jeweilige Entwicklungsphase |
Aufgenommen, aber leider keine Auswertung vorhanden |
Sollte unbedingt ausgewertet werden; ev. Koppelung mit Entwicklungsphasen |
|
Zuwachs |
Hinweis auf Kulmination der Zuwachsleistung als Charakteristikum für Entwicklungsphasen |
Ausgewertet p.PBF, Auswerteeinheit, Baumart, Revier,Gesamtwald |
Sollte weiterhin aufgenommen werden und später mit Entwicklungsphasen gekoppelt werden |
Zusammenfassend werden für Erfolgskontrolle und modellhafte Vergleiche die nachstehenden einrichtungstechnischen Aufnahmekriterien bzw. -verfahren vorgeschlagen:
|
Zweck |
Aufnahmekriterien, Aufnahmeverfahren |
|
Beurteilung Erfolg Rückentwicklung |
Baumartenmischung, Stärkeklassenverteilung, maximale Baumhöhen, Totholzanteil, Ansprache Naturnähe, Waldprofile |
|
Differenzierung Entwicklungsphasen |
direkte Ansprache Entwicklungsphase, Stärkeklassenverteilung, Totholzanteil, Zuwachsleistung, Altersbestimmungen, Baumformen |
|
Beurteilung Naturwaldeigenschaften |
Stammgrundfläche, Holzvorrat, max. Baumhöhen |
Tab. C-7: Aufnahmekriterien für die Erfolgskontrolle
3.3.2 Biologische Aufnahmen und Zustandsbeschreibungen
Entscheidende Kriterien dazu, wie weit sich die Waldungen des Sihlwaldes zu Naturwald zurückentwickelt haben, sind letztlich nicht nur durch ertragskundliche Aufnahmen beizubringen. Weitergehende Informationen können durch waldbiologische Untersuchungen zu Vorkommen und Bestand von Vögeln, Wild, Insekten, Pilzen, Flechten usw. erhoben werden. Anders als die einrichtungstechnischen Inventuren gehören solche waldbiologischen Feldaufnahmen leider noch nicht zur Routine der Waldplanung. Damit man in Zukunft über solche Informationen verfügt, sind besondere methodische Anstrengungen zu unternehmen.
Wie die Grundlagenstudie von HüNERWADEL/IRMANN ZIMMERMANN (1989) zeigt kann die Länge des Wegnetzes um mindestens die Hälfte der LKW-Strassen reduziert werden. Eine solche Redimensionierung sollte nach Massgabe der Ausdehnung der aus der Nutzung entlassenen Fläche und - vorerst noch - nach den Erfordernissen der Seilkranbringung vollzogen werden. Jede Erschliessungseinrichtung bedingt letztlich - sei es zur Benutzung oder zum Unterhalt - menschliche Präsenz und diese sollte im Einklang mit den übergeordneten Zielen des Projekts so weit als möglich vermieden werden.
Gewissen Anforderungen, die sich nicht nur auf die Kriterien des Holztransports beschränken dürfen, muss auch ein Netz mit geringerer Wegdichte genügen:
- Die Waldflächen müssen weiterhin für Aufsichtsorgane und Arbeitsequipen zugänglich sein, d.h. ein Minimum an Zufahrtswegen muss erhalten bleiben.
- Wo weiterhin Nutzung nötig ist und der Einsatz von Pferdegespannen zur Holzbringung sich eignet (Schwachholz), müssen vorläufig noch lastwagenbefahrbare Strassen in geeigneter Distanz erhalten bleiben.
- Auf der rund 1-2 km breiten Waldfläche des Sihlwaldes müssen - zumindest in den Zonen, wo naoch Eingriffe stattfinden - bei konsequentem Einsatz von Seilkransystemen einstweilen noch ein bis zwei, vorzugsweise horizontal verlaufende, lastwagenbefahrbare Strassen bestehen bleiben.
- Zur Gewährleistung einer genügenden Zugänglichkeit ist eine minimale Anzahl von Querverbindungen zu belassen.
Auf lange Sicht hinaus soll idealerweise auf das Befahren sämtlicher Wege mit Motorfahrzeugen verzichtet werden. Bestimmte verbleibende Wege sollen lediglich noch für leichte Pferdefuhrwerke und kleine Allradfahrzeuge (Rettungseinsätze) offengehalten werden.
Im Endzustand sollte ein Wegnetz zur Verfügung stehen, von dem aus jeder Punkt des Waldes zum Zweck von Aufsicht, Hilfeleistung oder Aehnlichem in nicht mehr als 20 Minuten Fussmarsch abseits Wegen erreichbar wäre. Dies bedeutet bei einer Hanghöhe von rund 400 m (Sihllauf 500 m, Albiskamm 900 m ü.M.) eine bis zwei Längswege und die notwendigen Ergänzungen gemäss folgender Näherung:
|
doppelte Längserschliessung auf 5 km Länge |
10 km |
|
einfache Längserschliessung auf 6 km Länge |
6 km |
|
vier Querverbindungen ab Talsolhle |
8 km |
|
Zuschlag für Kurven und nicht-ideale geometrische Feldaufteilung: +20% |
ca. 5 km |
|
insgesamt |
29 km oder 29 m'/ha |
Diese rein rechnerische Annäherung kommt der in der Grundlagenstudie vorgeschlagenen Länge von 32 km sehr nahe, so dass sich die beiden Schätzungen gegenseitig stützen.
Neben dem reduzierten LKW-Wegnetz gilt es aber ein ausgedehntes Netz von Arbeits-, Spazier-, Wander- und Fusswegen auszuscheiden und zu unterhalten. Die Grundlagenstudie kommt für diese Kategorie auf eine Restbestand von 94 km. Nach alter "Planermanier" kann der Bedarf nach Wanderwegen wie folgt abgeschätzt werden:
An einem schönen Wochenendtag kommen 2'000 Personen1) als Wanderer in den Sihlwald; aufgrund eines Gleichzeitgkeitsfaktors von 30%1) halten sich 900 Personen zur gleichen Zeit auf den Wanderwegen auf; sie wandern in Dreiergruppen2) und fühlen sich wohl, solange nicht mehr als 10 Gruppen à 3 Personen pro Stunde + Wegrichtung2) unterwegs sind; diese 60 Personen belegen, da sie sich mit 3.6 km/h 2) fortbewegen eine Weglänge von 3.6 km; um allen 900 Personen ein Wandern ohne "Stau" zu ermöglichen, sind deshalb 15 x 3.6 km oder 54 km Wanderwege nötig; da diese nicht alle gleich stark belegt sind, sind sie mit einem Faktor von 1.5 3) zu multiplizieren; es sind für den Wander- betrieb auf dem Albis also Wanderwege von 81 km Länge nötig.
1) Grundlagenstudie "Erholung in der Naturlandschaft Sihlwald" (Hesse+Schwarze+Partner, 1989)
2) nach J.JACSMAN (1972): Zur Planung von stadtnahen Erholungswäldern
3) gutachtliche Schätzung
Diese theoretische Berechnung kommt also - bringt man die rund 30 km LKW-Strassen als mögliche Wanderachsen in Abzug - auf eine geringere notwendige Wegdichte (50 km nicht LKW-gängige Wege gegenüber den aus der Grundlagenstudie zitierten über 60 km). Das Rechenexempel belegt andererseits, dass auf jeden Fall mit einem bedeutenden Wanderwegnetz zu rechnen ist, das auch instandgehalten werden muss. Die Länge beträgt rund das Doppelte dessen, was heute offiziell als Wanderwege ausgeschieden ist und ist auf alten Waldstrassen vorzusehen.
Die definitive Ausgestaltung des Erschliessungsnetzes sollte in einer auf die ganze nächste Planungsperiode (bis 2001) ausgedehnten Versuchszeit aufgrund von Beobachtungen und ev. Zählungen entworfen werden. Als Zielvorstellungen können die nachstehenden Zahlen ins Auge gefasst werden:
|
Wegtyp |
Länge |
Benützung für: |
|
LKW-Strassen |
30 km |
T S G (R)2) W |
|
Arbeitswege |
10 km |
S (G) (W) |
|
reine Wanderwege |
20 km |
G (R)2) W |
|
Erlebnispfade |
30 km 1) |
W |
|
insgesamt |
90 km |
Erklärungen:
|
LKW-Strassen: |
lastwagenfahrbare Strassen |
|
Arbeitswege: |
Erdwege oder nur schwach befestigte Trassee für Einsatz von Traktoren oder Pferden |
|
reine Wanderwege: |
befestigte Wege für Nebeneinherwandern mehrerer Personen |
|
Erlebnispfade: |
schmale, unbefestigte Fusswege zum Hintereinanderwandern |
|
T |
Transport von Holz mit LKW, Zufahrt mit allen Fahrzeugen |
|
S |
Schleppen von Holz mit Traktor oder Pferd; andere Arbeiten |
|
G |
Zufahrten mit geländegängigen Personenwagen |
|
R |
Rollstuhlfahrten |
|
W |
Wandern |
|
1) |
Stand Ende 1989 |
|
2) |
teilweise rollstuhlgängig: abhängig von Steigung und Ausbau |
Die gesamte Waldfläche und mit gewissen Einschränkungen die Reservatsfläche soll auch in Zukunft für jedermann frei zugänglich sein. Die Einrichtungen sind indessen so zu gestalten, dass daraus für die Realisierung des NLS-Projekts keine Nachteile entstehen. Die menschliche Präsenz - um es noch einmal zu wiederholen - soll möglichst diskret sein und womöglich keine Spuren hinterlassen. Je nach Teilgebiet (Waldesinnere, Sihlraum, Albisgrat, Agglomerationsnähe) sind unterschiedliche Ziele festzulegen:
- Waldgebiet (Sihlwald, Forst): Die Erholungsattraktivität im "gängigen" Sinn ist einzuschränken: weniger Ruhebänke, Tische, Abfallkörbe, Feuerstellen, Brunnen, keine Waldlehrpfade, Rundwanderwege, Container etc.. Wegweiser, Beschriftungen, Orientierungstafeln u.ä. sind auf ein Minimum zu reduzieren. Gewisse minimale Einrichtungen sind im Bereich bestehender Waldhütten zu konzentrieren (z.B. Feuerstellen, Tische, Bänke u.ä. im Langrain, Chrebsächerli, Wüesttobel, Streuboden im Sihlwald und Erlenmoos, Steinchratten im Forst). Sportliche Grossanlässe (OL-Läufe) sind keine mehr zu veranstalten.
- Sihlufer: Gestaltung gemäss separater Planung "Sihlraum": wahrscheinlich Förderung des Wanderns und ev. des Radfahrens; weitgehende Einschränkung von Camping, Lagern und Sportbetrieb. Das Sihlufer bildet einen integrierenden Bestandteil der Naturlandschaft Sihlwald, wird jedoch streckenweise eine bedeutende Zahl von Erholungssuchenden aufnehmen müssen.
- Uebrige Gebiete (Albiskamm, Horgenberg, Schweikhof, Langnau, Gattikon) sollen dem Erholungsbetrieb im gleichen Masse zur Verfügung stehen wie heute und damit Betriebsamkeit vom Waldgebiet ablenken. Gewisse Verbesserungen sind in der Grundlagenstudie "Erholung in der Naturlandschaft Sihlwald" zusammengetragen worden; die eigentliche Planung wird im Massnahmenbereich 5 "Raumplanerische Bezüge" erfolgen.
Die offiziellen und markierten Wanderwege haben als solche weiterzubestehen und sind mit geeigneten, diskreten Massnahmen zu unterhalten. Im ganzen Gebiet der Naturlandschaft Sihlwald soll aber auf jegliche "Verschönerung" oder "Aufwertung" durch hertransportierte oder in ihrer Lage veränderten Findlinge, durch Anlegen von Biotopen oder weitere gestalterische Massnahmen verzichtet werden. Wo solche schon erfolgt sind, ist im Detail abzuklären, ob durch Belassen oder Rückbau mehr an natürlicher Umgebung gewonnen werden kann.
3.6 Bildungseinrichtungen / Bildungsaktivitäten
Ein Entwurf zur konzeptionellen Planung des Bereichs Bildung liegt mit dem Bericht "Sihlwaldhäuser" von (EGLOFF und CATTANEO 1991) vor. Im Folgenden sollen lediglich gewisse Rahmenbedingungen umschrieben werden, die bei der Wahrnehmung von Bildungsaufgaben im Wald aus Rücksicht auf die Ansprüche der Naturlandschaft zu beachten sind.
Grundsätzlich sollte im ganzen Waldgebiet auf fest installierte Beschriftungen, Erklärungstafeln etc. verzichtet werden. Lediglich an Waldeingängen und zum Teil bei den Rastplätzen wäre das Anbringen von Orientierungstafeln sinnvoll. Alle weitergehende Information hätte dagegen in der Informationsstätte Sihlwaldhäuser oder auf Broschüren, Plänen und Beschrieben stattzufinden.
Die Wiederinstandstellung und ausstellungshafte Präparierung von kulturhistorischen Monumenten ist nur dort vorzusehen, wo einzigartige Resultate zu erwarten sind. In der Grundlagenstudie "Kulturhistorische Zeugen" vertritt Prof. Sablonier die Meinung, dass sich der Einsatz archäologischer Forschung lediglich im Bereich der Schnabelhöfe rechtfertigen würde. Andere Ausgrabungen wären dagegen "nicht lohnend (wie bei den kläglichen, inhaltlich wenig aussagekräftigen Resten der Waldbahn) oder zu aufwendig (wie beispielsweise grossräumige Sondierungen zur Erfassung früherer landwirtschaftlicher Nutzung oder Besiedlung)". Zuständig für Grabungen sei allerdings die kantonale Denkmalpflege und die Zürcher Stadtarchäologie.
Obwohl der Sihlwald "in seiner gegenwärtigen Form schon für sich selber ein Zeugnis ... verschiedener historischer Waldkultivierungsformen" darstelle, kann Prof. Sablonier der Erhaltung von Waldbauformen als Naturdenkmäler im Sihlwald nichts abgewinnen. Es könne für diese denkmalpflegerische Aufgabe keine höhere Legitimierung beansprucht werden; ihre Wahrnehmung sei "problemlos auch an vielen anderen Orten möglich".
Prof. Sablonier warnt eindrücklich vor einem Erholungs-Rummelpark und wäre - aus der Sicht des Historikers - sogar bereit, die Wegunterhaltsarbeiten und damit die "Zugänglichkeit in Zukunft auf den Gratweg und den Spinnerweg [zu] beschränken". Wichtiger als die Arbeit mit Schaufel und Spachtel scheint ihm die "Sicherung und Aufarbeitung des reichen archivalischen Quellenmaterials" sowie dessen "Nutzbarmachung in verschiedenen Formen für die Umwelterziehung bei Kindern und Erwachsenen". Er spricht in seiner Beurteilung gar "von einer eigentlichen Pionierfunktion des Sihlwaldprojekts für die Forschung (und deren Umsetzung)".
Diese Stellungsnahme von kompetenter Seite spricht dafür, dem Naturwald möglichst breiten Raum zu lassen und ihn nicht mit kulturellen, technischen oder waldbaulichen Rückblenden und Lehrstücken zu durchlöchern.
In der Bestandeskarte sind waldfreie Flächen nach ertragslosen Waldflächen und offenen Flächen (=Nicht-Waldflächen) unterschieden. Die darauf basierende Planimetrierung hält sich nicht an diese Unterscheidung, sondern weist nur eine Kategorie, die "landwirtschaftlichen, offenen und unproduktiven" Flächen aus. Diese umfassen insgesamt gut 40 Hektaren, zusammengesetzt aus den folgenden Kategorien:
|
Kategorie |
Fläche in ha |
||
|
Sihlwald 1 |
Sihlwald 2 |
Total |
|
|
Landwirtschaft |
15.17 |
8.63 |
23.80 |
|
Gewerbe/Siedlung1) |
3.58 |
6.79 |
10.37 |
|
Nicht-Wald-Riedflächen2) |
1.33 |
3.12 |
4.45 |
|
unbestockte Waldfl.3) |
0.73 |
3.17 |
3.90 |
|
waldfreie Flächen total |
20.81 |
21.71 |
42.52 |
1) Tankanlage Station Sihlbrugg, Schulhaus Sihlwald, Berg-
gasthaus Albishorn, Werbetrieb, Restaurant und Wohnhaus
Sihlwald
2) Naturschutzgebiete Langmoos, Erlenmoos und Summerhalden
3) Waldlichtungen, waldlose Rutschflächen etc.
Tab. C-8: Flächenverteilung der waldfreien Flächen
Natürlich waldfreie oder von Menschenhand gerodete, mit annähernd natürlicher Vegetation bewachsene Flächen sind gesamthaft gesehen nur in geringen Anteilen vorhanden: nur je 0.4% ausgedehntere Riedflächen einerseits und Waldlichtungen andererseits. In den Grundlagenstudien über die Fauna, die Vegetation und die Erholungsnutzung wird die Bedeutung waldfreier Flächen verschiedentlich hervorgehoben. Sie sind historische Relikte und bereichern die Oekologie des Gebietes, bieten ergänzende Lebensräume für Pflanzen oder Tiere und erfreuen mit ihren Ausblicken und Lichtspielen den erholungssuchenden Menschen. Im Rahmen des NLS-Projekts ist es deshalb von Bedeutung, solche Flächen waldfrei zu halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich darauf - wohl wissend, dass es sich z.T. um künstlich geschaffene Landschaftselemente handelt - eine angepasste Vegetation z.B. eine gemähte Magerwiese, ein Schilfbestand oder ein Seggenried entwickeln kann.
In der Grundlagenstudie "Vegetation" wird die Frage aufgeworfen, "ob im Hinblick auf die biologische und landschaftliche Vielfalt wieder vermehrt offene Bereiche geschaffen werden sollen". Die Autoren sind der Meinung, dass es früher im Sihlwald mehr waldfreie Standorte gegeben hat. Deutliche Hinweise dafür seien "etliche kleinflächige Vorkommen von Kleinseggen- oder Pfeifengras-Sümpfen (...) höchstwahrscheinlich Reste von ehemaligen Streuwiesen". Uebergänge zu solchen früheren oder noch bestehenden, offenen Flächen finden sich oft auf wechseltrockenen Standorten mit den folgenden Waldgesellschaften:
- wechseltrockene Lungenkraut-Buchenwälder mit Immenblatt (10w)
- wechseltrockene Zahnwurz-Buchenwälder (12w)
- wechseltrockene Weisseggen- (14w) und Bergseggen-Buchenwälder (15w)
- Eiben-Buchenwälder (17)
- Pfeifengras- (61) und Orchideen-Föhrenwälder (62) (mit stark wechselnden Wasserverhältnissen).
Die gewollte Beschränkung der menschlichen Präsenz in der zukünftigen Naturlandschaft an der Sihl steht dem Ansinnen, weitere Flächen mit aktiven Gestaltungsmassnahmen waldfrei zu halten, diametral gegenüber. Aus Gründen der Konsequenz ist deshalb darauf zu verzichten.
Im Hinblick auf den ökologischen Wert von Freiflächen im Waldareal wäre es wünschenswert, in Zukunft unbewaldete Kleinflächen dauernd waldfrei zu halten. Der Erhaltung und Gestaltung von inneren Waldrändern ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Auf allen übrigen waldfreien Flächen (inklusive Landwirtschaftsgebiet) ist auf eine möglichst naturnahe Bewirtschaftung bzw. Nutzung hinzuwirken. Auf den Austrag von Dünger und Giftstoffen ist gänzlich zu verzichten.
Im Betriebsplan (Teil D) sind die im Waldareal gelegenen Flächen, die dauernd offen zu halten sind, ausgeschieden und die dazu notwendigen Massnahmen festgehalten (siehe Kapitel DIII-4.1).
Der Wert eines Waldsaumes mit einer Busch- und Strauchzone kann von natürlich vorkommenden Waldrändern, wie wir sie an Mooren oder Seen finden können, abgeleitet werden. Im Waldrandbereich überschneiden sich die Lebensräume der an Schatten und Deckung angepassten Waldarten und der lichtbedürftigen Offenlandarten. Es wundert deshalb nicht, dass in einem derartigen Saumbiotop eine grosse Artenvielfalt anzutreffen ist. Aehnliche Verhältnisse bieten auch Hecken. Die heute bestehenden Waldränder sind andererseits Produkte menschlicher Eingriffe, denen wir nun - da natürliche Lebensräume rar geworden sind - eine künstliche und künstlich erhaltene Natürlichkeit zu verleihen angehalten sind.
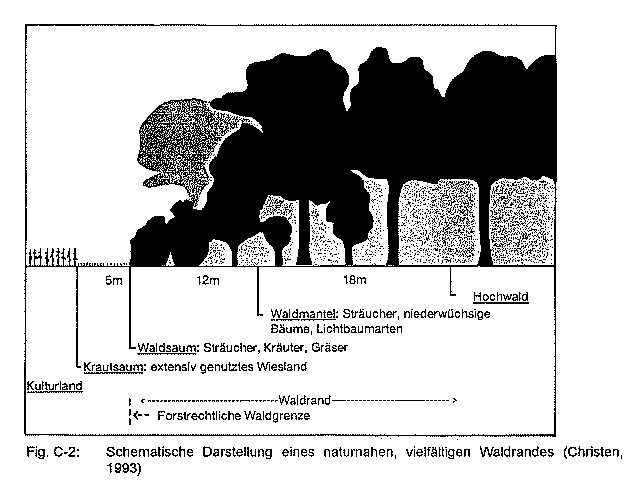
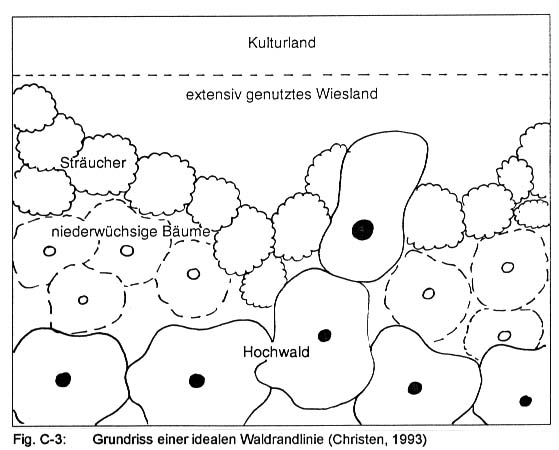
In Anlehnung an natürliche Waldränder kann von einem naturnahen, ökolgisch wertvollen Idealbild eines Waldrandes gesprochen werden, das generell für alle Waldränder anzustreben ist. Dieses besteht aus einem stufigen Übergang zwischen Wald und Kulturland. Im Waldmantel stehen vor allem Lichtbaumarten durchsetzt mit Sträuchern und niederwüchsigen Bäumen. Im offenen, meist landwirtschaftlich genutzten Vorland, schliesst sich ein 2-5 Meter breiter, extensiv genutzter Wiesenstreifen an, wie es in den Abbildungen Fig. C-2 und Fig. C-3 dargestellt ist. Die Waldrandlinie ist im Idealfall durch Buchten und Nischen aufgelockert und unterbrochen. Die Waldfront bietet dadurch unterschiedlichste Lebensräume und bereichert das Landschaftsbild.
Aktive Gestaltungs- und Erhaltungsmassnahmen sind notwendig, um auf die Dauer einen Waldsaum mit Gebüschen, Sträuchern und halbhohen Bäumen auf einer Tiefe von 30 Metern zu erhalten. Andernfalls werden - zumindest dort, wo Bewirtschaftung oder Nutzung das Vorland waldfrei hält - mit der Zeit und bis auf den letzten Meter Waldbäume aufkommen und die wertvolle Kleinvegetation verdrängen.
Auf die Waldrandsiuation im Sihlwald wurde bereits unter Kapiel B-1.5.3 hingewiesen.
Der ökologische Wert eines Waldrands kann, je nach Ausgangslage, auf verschiedenen Wegen verbessert werden:
- Wo der seltene Fall besteht, dass man über das Vorgelände verfügen kann, ist es möglich, die Waldvegetation herauswachsen zu lassen oder durch gezielte Pflanzungen einen ökologisch wertvollen Waldsaum vorzulagern. Hochstämme sind auf diesen vorgelagerten Flächen dauernd zu vereinzeln.
- Wo Waldbestände bis zum Waldrand hin verjüngt werden, ist im Zuge der Wiederbewaldung ein Streifen von gegen 30 m durch entsprechende Hiebe und Artenwahl zu einem ökologisch wertvollen Waldsaum zu gestalten. Bis in ein gewisses Alter (20 bis 25 Jahre) kann dies auch nachträglich noch nachgeholt werden.
- Schwieriger ist eine Aufwertung des Waldsaums in älteren Beständen: die Entfernung oder Auflöcherung der schutzspendenden Reihe der Randbäume ist in exponierten Lagen nicht zu empfehlen, und, um Gebüsche und Sträucher hochzubringen, sind andererseits Aushiebe von etwelcher Ausdehnung notwendig.
Der im Sihlwald weitaus häufigste Fall wird jedoch ausgerechnet diese letzte, eher problematische Kategorie sein. Die Schaffung natürlicher Waldrandzonen wird also eine längere Gestaltungsphase benötigen und in eine dauernde Unterhaltsaufgabe ausmünden. Neben der Erhaltung unbewaldeter Flächen wird die ökologische Aufwertung und "Instandhaltung" der Waldränder eine weitere Gestaltungsmassnahme sein, die im Rahmen des Projekts NLS dauernd zu erfüllen sein wird.
Für die detaillierte Planung der Waldrandgestaltung kann an dieser Stelle auf die Zusammenstellung 'Aufwertung des Lebensraumes Waldrand, Kartierung, Pflege und Planung am Beispiel des Forstreviers Zürichberg/Adlisberg' (Christen M., 1993) verwiesen werden.
Im Naturwald an der Sihl sollen Bachverbauungen nur dort erhalten bzw. unterhalten werden, wo diese zum Schutz wichtiger Einrichtungen notwendig sind. Zu diesen zählen die Siedlungs- und Gewerbeflächen, das Trassee der Sihltalbahn und die Sihltalstrasse, nicht aber unbedingt die verbleibenden Waldstrassen und Wege. Wo sich Erosion einstellt, ohne Schäden an Einrichtung zu bewirken, ist sie als natürliches Phänomen hinzunehmen: die solcherart stattfindenden Prozesse sind Teil der Naturlandschaft selbst.
Prozesse der Renaturierung im Bereich der Seitenbäche sind, weil zahlreiche Sperren baufällig oder gar verfallen sind, an vielen Orten mit der Bildung von Anrissen und Kolken in Gang gekommen. Wo - wie vorwiegend auf der rechten Talflanke - die Risiken der Eintiefung von Gerinnen und nachfolgend von mitteltiefen Rutschungen und Absackungen gering sind, können solche Renaturierungsansätze gezielt weitergeführt werden. Auf der linken Talseite sind dagegen - bei gewollter oder spontan entstehender Renaturierung - Auswirkungen auf Waldstrassen, Kantonsstrasse und Sihltalbahn nicht auszuschliessen. Da der Untergrund zum überwiegenden Teil aus feinkörnigem Material besteht, ist allerdings nicht mit einem bedeutenden Geschiebeanfall zu rechnen.
Eine Untersuchung zur Abschätzung des Gefährdungspotentials von zwei ausgewählten Bachläufen (BASLER & HOFMANN/STEIGER, 1992) kommt zum Schluss, dass nach "einer vollständigen Renaturierung des Tommenbaches und des Eichbaches weder für die Sihltalstrasse, noch für die Sihltalbahn mit einer markanten Zunahme des Gefährdungspotentials zu rechnen ist". Voraussetzung dafür seien allerdings lokale Schutzvorkehren an den Verkehrsbauten sowie die Gewährleistung des Geschieberückhaltes an geeigneten Stellen.
Unter Fachleuten umstritten ist die Wirkung von Verklausungen durch umgestürzte Bäume und vor allem die Frage, ob Stauungen sich schlagartig in Sturzwellen entladen könnten. Die Autoren der Grundlagenstudie "Wasserbau & Sicherheit" (BASLER & HOFMANN 1988) halten diese Gefahr im Sihlwald "von untergeordneter Bedeutung", sofern auf der linken Talseite nur "gezielte, streckenweise Renaturierungsversuche" an die Hand genommen werden.
Anlässlich einer Begehung (vom 30.10.90) wurden die nachstehenden grundsätzlichen Beobachtungen und Ueberlegungen zum Thema der Renaturierung der Seitenbäche festgehalten:
- Die meisten Verbauungen dienen der Sicherheit der Waldstrassen und weit weniger derjenigen von Kantonsstrasse und Sihltalbahn.
- Wo "nur" die Sicherheit der Waldstrassen auf dem Spiel steht, sollten
. nicht Sicherheitsansprüche wie bei einer Hauptverkehrsstrasse gelten;
. Durchlässe womöglich durch Furten ersetzt werden;
. Bauwerke in einer sanften Bauweise erstellt sein oder dahin umgebaut werden.
- Obwohl die Standortsgemeinden für den Unterhalt der Bäche zuständig wären und nur 50% der Kosten auf die Grundeigentümer überwälzen können, hat die Stadt Zürich den Unterhalt der Bäche bisher auf freiwilliger Basis selbst getragen. Wenn im Sinne des Projektes 'NLS' auf künstliche Bachgestaltungen verzichtet wird, kann dies auch in Zukunft so bleiben und in einer Vereinbarung zwischen der Stadt und den Hoheitsgemeinden festgehalten werden. Die Stadt Zürich wird im Rahmen des NLS-Projekts auch für die Sicherheit haften müssen, soweit noch von einer Werkhaftung gesprochen werden kann.
- Wo die Wirkung von Verbauungen gelenkt oder spontan vermindert wird, ist zu prüfen, ob im Bereich oberhalb von Bahn oder Kantonsstrasse eine Geschiebefalle einzurichten ist (Faustregel: 100 m3 Kapazität pro km2 Einzugsgebiet und bei zweimaliger Entleerung pro Jahr).
- Es wird eine Studie angeregt, in der die Sicherheitserfordernisse für Kantonsstrasse, Bahntrassee und Sihl festzuhalten sind. Daraus könnte abgeleitet werden, an welchen Bächen oder Bachabschnitten weiterhin Unterhalt geleistet werden muss und an welchen darauf zu verzichten ist (beispielhafte Studien sind am Tommenbach und am südlichen Eichbach vorgenommen worden; weitere sollten folgen).