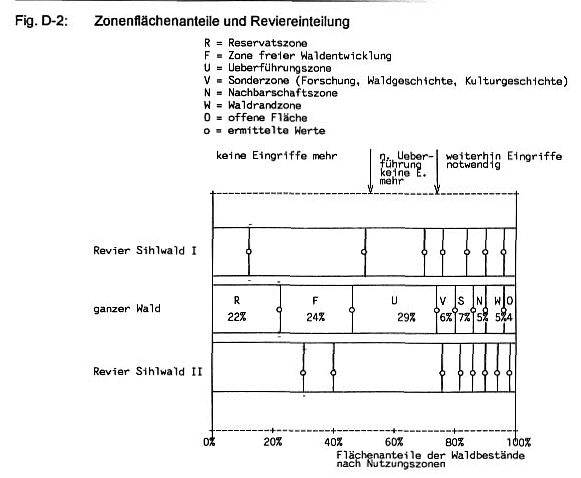
III Planung der Periode 1991 - 2001
Die vorliegende Waldplanung ist die Fortsetzung der
waldbaulichen und gestalterischen Massnahmen, wie sie schon seit Mitte
der achziger Jahre im Gang sind (vgl. Kapitel B-2.5 + B-3.4). Aufgabe der
Planung ist es, einen ersten 10-Jahres-Schritt vorzuzeichnen in Richtung
auf die ideellen Ziele des Projekts (vgl. Kapitel C-1.1, C-1.4, C-2); d.h.:
- als Menschen treuhänderisch Aufgaben des Schutzes
und der Gestaltung zu übernehmen und zugleich sich möglichst
zurückzuziehen, um einen Raum zu schaffen, wo nicht wir allein bestimmen,
was zu geschehen hat.
- Waldflächen, deren gegenwärtiger Zustand
auf lange Sicht keine naturwaldähnliche Struktur erwarten lässt,
sind in den nächsten 10 bis 60 Jahren durch entsprechende Eingriffe
in wertvollere Lebensgemeinschaften zu überführen.
- Die aus der Nutzung entlassenen Waldbestände
mit ihren Baumindividuen, sollen so alt und so gross werden können,
wie ihre Biologie und die Umwelt es zulassen. Der freien Entwicklung ist
keine künstliche Grenze zu setzen.
- Die dem Naturwald zugehörige Tier- und Pflanzenwelt
soll absoluten Schutz geniessen; lediglich das Hochwild soll durch jagdliche
Massnahmen so weit in Schranken gehalten werden, dass die natürliche
Waldverjüngung ohne Zaun gewährleistet ist.
Aufgrund der Zielsetzungen sind acht verschiedene
Zonen ausgeschieden worden (Erläuterungen im nachfolgenden Kapitel
2.3):
2. Zone freier Waldentwicklung (keine Eingriffe)
3. Ueberführungszone (gelenkte Waldentwicklung zur Schaffung natürlicher Waldformen)
4. Sonderzone (wissenschaftliche Versuchsflächen, kulturhistorisch oder waldgeschichtlich erhaltenswerte Gebiete)
5. Sicherheitszone (Beseitigung von Gefährdungsmomenten entlang von Verkehrswegen)
6. Nachbarschaftszone (Rücksicht auf Bewirtschaftung benachbarter Waldgrundstücke)
7. Waldrandzone (Förderung natürlicher Uebergangsvegetation)
8. Offene Flächen
Die Ausscheidung der Zonen erfolgte anhand verschiedener
Grundlagen, die im Rahmen der Grundlagenstudien und der Arbeiten zur Waldplanung
erhoben wurden. Es sind dies:
Bearbeitet von der Beratungsgemeinschaft für Umweltfragen (BGU; vgl. Kapitel B-1.5)
. Ausscheidung der Waldgesellschaften
. Beurteilung von Naturnähe und Anteil an ökologisch problematischen Baumarten (naturnah, naturfern und naturfremd)
. Kartierung der ökologischen Wertigkeit der Waldränder
. Kartierung und Beschreibung von waldfreien Standorten
. Beschreibung von Beständen mit erhöhter
Strukturvielfalt (seltene Waldgesellschaften, geomorphologische oder hydrologische
Besonderheiten, Altholzbestände, Baumdenkmäler, ansprechende
Waldausschnitte u.a.)
- Oekologische Wertanalyse 1989
Erarbeitet vom Büro für Siedlungs- und Umweltplanung (BSU; vgl. Kapitel BI 3.7). Beurteilung des ökologischen Wertes von Wald, Waldrändern und waldfreien Standorten in vier Stufen (sehr hoch, hoch, mittel, gering). Es wurden im wesentlichen die folgenden Wertvariablen miteinander verknüpft:
. zu 5/8: Seltenheit, Naturnähe und Vielfalt der Vegetation (Gewichtung 1:3:1)
. zu 3/8: Seltenheit, Naturnähe und Vielfalt der Vogelarten (Gewichtung 1:1:1)
. Zuschlag für Totholzreichtum
- Plan "Voloscuk" 1990
In einem Gutachten von Ivan Voloscuk, Direktor Nationalpark Hohe Tatra, wurden die folgenden Einheiten festgehalten:
Ib Bestände, in denen in der Vergangenheit nur schwach eingegriffen wurde; Struktur und Baumarten nicht verfälscht, Naturverjüngung vorhanden; keine Eingriffe
IIa Bestände mit standortfremden Baumarten; Eingriffe nötig
IIb Bestände mit standortgerechten Baumarten aber nicht optimaler Verteilung und Struktur; strukturverbessernde Massnahmen vonnöten
IIIa Reinbestände aus vorwiegend Fichte; Eingriffe nötig
IIIb Junge Bestände mit mangelnder Struktur, fehlender Mischung oder nicht standortgerechten Baumarten; Eingriffe nötig
IV Waldränder
Bestandesbeschreibung und waldbauliche Ansprache durch Revierförster und Mitarbeiter Stadtforstamt. Daraus verwendet wurden:
. Bestandesbeschreibung
. gutachtliche Beurteilung der Eignung als Reservatsfläche
- Bestandeskarte 1991
Einteilung des Sihlwaldes in Waldbestände aufgrund
von Orthophoto und Verfikation im Gelände. In der codierten Beschreibung
sind Entwicklungsstufe (Alter), Mischungsgrad (Anteil Nadel-/Laubbäume)
und die Hauptbaumart festgehalten. Die Bestandeskarte wurde in einem geographischen
Informationssystem (ArcInfo) festgehalten und verarbeitet.
- Waldentwicklungstypenkarte 1992
Nach Planung Voloscuk von Forsting. F. Mahrer weiterentwickelt. Der Sihlwald wurde, nach folgenden Kriterein, in drei Zonen gegliedert:
. Freie Waldentwicklung: Bestand stufig oder Oberschicht älter als 60 Jahre und Deckungsgrad der Mittelschicht grösser als 0.3
. Gelenkte Waldentwicklung: Bestand jünger als 60 Jahre oder mit in der Oberschicht dominierenden Fichten, Douglasien oder Lärchen
. Verbleibende Fläche als nicht zugeordnete
Bestände
Erster und entscheidender Schritt bei der Zoneneinteilung ist die Zuweisung der Bestandesflächen entweder
. zur Zone der freien Waldentwicklung oder
. zur Zone der Ueberführung.
In dem auf der nächsten Seite dargestellten
Entscheidungsschema sind die vorgenannten Grundlagen integriert und der
Weg dargestellt, nach welchem im Detail entschieden wurde, welcher der
beiden Zonen eine Bestandesfläche zuzuteilen war.
Alle weiteren Zonenzuweisungen sind diesem Entscheidungsschema nachgeordnet. Es sind dies:
- die Sonderzone, aufgrund bisheriger Praxis und anhand der Grundlagenstudien
- die Sicherheitszone, entlang von Verkehrswegen
- die Nachbarschaftszone, entlang benachbarter Waldgrundstücke
- und die Waldrandzone, entlang anstossendem Freiland.
Kriterien: Die Festlegung der Reservatsfläche
erfolgte als letzter Schritt nach der Ausscheidung aller übrigen Zonen.
Die Reservatszone wurde aus Flächen der Zone freier Waldentwicklung
gebildet. Sie soll durch klare topographische Grenzen erkennbar sein und
eine möglichst grosse, zusammenhängende Fläche umfassen.
Die Reservatszone soll einen Querschnitt durch den Sihlwald vom Albiskamm
bis hinunter zur Sihl und zumindest ein vollständiges Wildbachsystem
- vom Einzug bis zur Mündung in die Sihl - umfassen (es umfasst im
wesentlichen die Abteilungen 10, 11, und 13-19 mit dem Eichbach sowie das
Brunnentobel, Abt.32).
- Verzicht auf Beerntung von Samenbäumen
- Wegegebot für Waldbesucher
- Jagd/Wild: keine Fütterung, Schutz von Weisstannen- und Eibenaufkommen
- Fahrverbot für betriebsfremde Fahrzeuge; Erschwerung
der Durchfahrt für Fahrzeuge des Forstbetriebes
2.3.2 Zone freier Waldentwicklung
Kriterien: Auf der Basis der Waldentwicklungstypenkarte von F.Mahrer wurden in einem ersten Schritt stufige, naturnahe Bestände oder Bestände von mehr als 60 Jahren, mit einer deutlich vorhandenen Mittelschicht (Deckungsgrad > 0,3), - das heisst mit der Anlage zur Stufigkeit -, in die Zone freier Waldentwicklung eingeteilt. In einem zweiten Arbeitsgang wurden zusätzlich jene Bestände ausgeschieden, die aufgrund der Vegetationsstudie als naturnah und als strukturreich beschrieben worden sind.
In einem dritten Schritt wurden ergänzend in die freie Waldentwicklung eingeteilt:
. Bestände mit einem hohen bis sehr hohen ökologischen Wert (gemäss ökologischer Wertanalyse),
. Bestände, die gemäss waldbaulicher Planung der Förster bzw. gemäss Gutachten von I. Voloscuk als reservatstauglich bezeichnet worden sind.
- Einzelmassnahmen im Sinne des Schutzziels sind nicht ausgeschlossen
- Wegempfehlung für Waldbesucher
Kriterien: Alle Bestände, die anhand des vorgenannten Entscheidungsweges nicht in die freie Waldentwicklung einzuteilen waren, wurden vorerst der Ueberführungzone zugewiesen. Es sind dies in erster Linie Bestände,
. die in der Oberschicht einen grossen Anteil an Fichten, Lärchen oder Douglasien aufweisen.
- Überführungsdurchforstungen in Naturwaldformen,
zur Förderung der Strukturdiversität mit Korrektur der Baumartenverteilung
(vgl. Kapitel: DIII-3.1.2)
a) Versuchsflächen (ETH/WSL/Pro Silva Helvetica), (vgl. Kapitel B-3.5)
Ziel: Weiterführung der wissenschaftlichen Versuche
Kriterien: Bestehende Versuchsflächen
Massnahmen: Gemäss Versuchsanordnung (vgl. DIII-3.1.5,
DIII-3.1.7)
b) Bestände von waldgeschichtlicher Bedeutung
Ziel: Erhalten eines Beispiels der traditionellen Waldbewirtschaftung (Lärchen, Föhren und Fichten angebaut nach dem Vorwaldsystem von Gehret, Abt.27 (vgl. Kap. B-3.4), bzw. Erhalten der ältesten Buchen im Sihlwald (Roosveltplatz, Abt.20)
Kriterien: Gutachten von I. Voloscuk
Massnahmen: Auslesedurchforstung in den Jungbeständen,
Vitalitätsförderung im Altholz, kein Endabtrieb (Abt.27); keine
Massnahmen beim Roosveltplatz (Abt.20); (vgl. DIII-3.1.7)
c) Bestände auf Stätten von kulturhistorischer Bedeutung (Schnabelburg-Höfe)
Ziel: Erhalten der topographischen Strukturen, denen unter Umständen noch Hinweise auf die mittelalterlichen Höfe der Schnabelburg entnommen werden können
Kriterien: Fundstelle/Ausgrabungen
Massnahmen: grundsätzlich keine Massnahmen (vgl.
DIII-3.1.7)
Kriterien: Entlang allen öffentlich befahrbaren
Strassen (Sihltalstrasse, Albisstrasse, Tobelstrasse, Ragnaustrasse, Forststrasse
und Tabletenstrasse) sowie entlang der Sihltalbahn wird beidseitig ein
50 Meter breiter Streifen Wald der Sicherheitszone zugeteilt. Wege und
topographische Gegebenheiten sind bei der Zonenabgrenzung zu berücksichtigen.
Massnahmen: Überführungsdurchforstung in
Naturwaldformen zur Förderung der Strukturdiversität mit Entfernung
von sturzgefährdeten Bäumen (vgl. DIII-3.1.3)
Ziel: Schutz für angrenzende, traditionell genutzte
Waldbestände vor unerwünschten Auswirkungen des sich selbst überlassenen
Waldes.
Kriterien: Grenzt ein Waldbestand an Waldungen im
Besitz Dritter, wird entlang der Grenze ein 50 Meter breiter Streifen der
Nachbarschaftszone zugeteilt. Verläuft die Grenze des Waldbesitzes
entlang eines deutlichen Grates, wird auf die Ausscheidung der Nachbarschaftszone
verzichtet. Wege und topographische Gegebenheiten sind bei der Zonenabgrenzung
zu berücksichtigen.
Massnahmen: Rücksicht auf die Anforderungen der Nachbarbestände:
Ziel: Gestaltung von ökologisch wertvollen Waldrändern
Kriterien: Grenzt ein Waldbestand an waldfreie Flächen,
wird ein 30 Meter breiter Waldstreifen der Waldrandzone zugeteilt.
Massnahmen: Schaffen und Erhalten einer ausgeprägten
Strauch- und Niederbaumschicht mit einer buchtigen, abwechlungsreichen
Waldrandlinie (vgl. DIII-3.2).
Ziel: Offene Flächen waldfrei halten, extensiv
bewirtschaften sowie erhalten und pflegen geschützter und seltener
Biotope.
Kriterien: Nicht bestockte Fläche, die langfristig
offen bleiben soll (kein Waldcharakter). Zahlreiche kleine, in der Bestandeskarte
als Offenfläche ausgewiesene Flächen, mit mehrheitlichem Waldcharakter
werden im Rahmen der Zoneneinteilung als Waldfläche ausgewiesen. Als
wertvolle, angrenzende Offenfläche, wurde auf dem Zonenplan das Langmoos,
im Besitze des Naturschutzbundes miteinbezogen.
Massnahmen: Die Offenflächen können in
landwirtschaftlich genutzte und naturschützerisch wertvolle Flächen
unterteilt werden. Für die Landwirtschaftsflächen sind die entsprechenden
Pächter zuständig. Für die Pflege der Naturschutzflächen
ist in den meisten Fällen der Forstdienst zuständig. Eine Beschreibung
der Massnahmen folgt in Kapitel DIII-4.1)
.
. nach Revieren
. nach Alterklassen
. und nach dem Mischungsverhältnis Nadel-/Laubholz
Rund die Hälfte der Fläche des Sihlwaldes
wird zum heutigen Zeitpunkt aus der Bewirtschaftung entlassen, 22% in die
Reservatszone und 24% in die freie Waldentwicklung. Weitere 29% bilden
die Ueberführungszone und werden früher oder später Teil
der rund vier Fünftel des Sihlwaldes sein, in denen keine Eingriffe
mehr stattfinden sollen. Langfristig sind Eingriffe nur noch auf einem
Flächenanteil von rund 25% notwendig.
- Nach Revieren:
Im Revier Sihlwald I nehmen die Zonen der freien
Waldentwicklung sowie diejenigen Flächen, in denen auch auf lange
Sicht Eingriffe stattfinden müssen (Waldrandzone, Nachbarschaftszone,
Sicherheitszone und Sonderzone), einen deutlich grösseren Anteil ein
als im Revier II. Letzteres ist eine Folge der engen Verzahnung der Waldflächen
rechts der Sihl mit Strassenzügen, Nachbarbeständen und offenem
Land. Demgegenüber haben die Reservatszone sowie die Zone, wo noch
Ueberführungsschläge stattzufinden haben, einen grösseren
Anteil im Revier II. Ausgedehnte Ueberführungsschläge sind namentlich
in den Abteilungen 20 bis 25 notwendig, wo in den vergangenen 80 Jahren
grosse Flächen verjüngt worden sind.
- Nach Entwicklungstufen:
. Reservatszone: grosse Anteile von 100-120-jährigen und stufigen Beständen; bedeutende Anteile der 60-100-jährigen Bestände
. freie Waldentwicklung: grosse Anteile der 60-100-jährigen, der über 120-jährigen und der stufigen Bestände; bedeutende Anteile der 40-60-jährigen und der 100-120-jährigen Bestände
. Ueberführungszone: grosse Anteile der 0-60-jährigen Bestände; bedeutende Anteile der 60-100-jährigen und der über 120-jährigen Bestände
. Zonen dauernder Eingriffe (Sonder-, Sicherheits-,
Nachbarschafts- und Waldrandzone): auffällig geringer Anteil der 60-80-jährigen
Bestände (wahrscheinlich ein Zufall)
- Nach Mischungsverhältnis Laub-/Nadelholz:
(die vier Klassen werden im folgenden mit "L90" für über 90% Laubholz, mit "L50-90" für 50-90% Laubholz, mit "N50-90" für 50-90% Nadelholz und mit "N90" für über 90% Nadelholz bezeichnet)
. Reservatszone: grosser Anteil L90 und L50-90
. freie Waldentwicklung: grosser Anteil L90 und L50-90, bedeutender Anteil N50-90
. Ueberführungszone: grosser Anteil N90 und N50-90, bedeutender Anteil L50-90 und L90
. Zonen dauernder Eingriffe: etwas grössere
Anteile in N90 und N50-90 als in laubholzdominierten Beständen
- die aus der Waldbehandlung entlassenen Waldbestände sind meist über 60-jährig oder stufig, die Ueberführungsbestände dagegen mehrheitlich unter 60-jährig, wobei eine breite Ueberlappungszone bis hinunter zu 40-jährigen und hinauf zu 100-jährigen Beständen besteht;
- die Reservatszone konzentriert sich fast ausschliesslich, die Zone freier Waldentwicklung zu einem überwiegenden Teil auf laubholzdominierte Bestände;
- umgekehrt die Ueberführungszone, die einen Grossteil der nadelholzdominierten Bestände umfasst, aber auch in die laubholzdominierten überlappt.
| Abt.
Nr. |
Reser-
vats- zone |
Zone
freier Wald- entw'g |
Ueber-
führ'g zone |
Sonderzone | Sicher
heits- zone |
Nachb.
schaft zone |
Wald-
rand- zone |
offene
Fläche |
Bemerkungen |
| R | F | U | V | S | N | W | O | ||
| 01 | 16.37 | 4.96 | 1.53 | 0.97 | |||||
| 02 | 22.55 | 1.85 | 2.05 | 1.23 | |||||
| 03 | 23.50 | 0.68* | 2.09 | 0.84 | * Waldprofil Schönboden | ||||
| 04 | 30.83 | 2.80 | 3.13 | ||||||
| 05 | 12.89 | 6.39 | 0.92 | 2.14 | |||||
| 06 | 21.96 | 5.77 | 4.17 | 0.92 | 1.25 | ||||
| 07 | 7.66 | 19.34 | 0.20 | 0.51 | |||||
| 08 | 15.68 | 7.07 | 2.38 | ||||||
| 09 | 6.70 | 13.46 | 0.45 | ||||||
| 10 | 15.29 | 1.47 | |||||||
| 11 | 17.66 | ||||||||
| 12 | 26.15* | 3.01 | *Plenterversuchsfläche | ||||||
| 13 | 13.40 | 0.80* | *Durchf.versuchsfl. WSL | ||||||
| 14 | 14.24 | 4.64 | 1.92* | 3.79 | *Durchf.versuchsfl. WSL | ||||
| 15 | 18.63 | ||||||||
| 36 | 11.33 | 6.39 | 1.23 | 5.18 | 4.37 | 0.43* | *ohne Langmoos (3ha) | ||
| 37 | 9.18 | 9.32 | 8.64 | 3.59 | 4.57 | 3.13 | |||
| 38 | 10.06 | 3.82 | 2.35 | 4.79 | 5.23 | 4.52 | |||
| 39 | 8.17 | 2.80 | 1.91 | 5.23 | 6.79 | ||||
| 40 | 0.35 | 5.99 | 1.45 | 0.27 | |||||
| 41 | 6.17 | 5.39 | 1.44 | 1.91 | |||||
| Sw I | 64.98 | 192.75 | 103.54 | 29.55 | 42.22 | 32.39 | 28.51 | 18.30 | = 512.24 ha |
| 16 | 25.08 | 2.37 | 1.63 | ||||||
| 17 | 25.73 | 0.06 | |||||||
| 18 | 36.93 | 0.26 | 0.10 | 0.25 | 1.45 | ||||
| 19 | 30.04 | ||||||||
| 20 | 1.16 | 25.11 | 0.45* | 5.16 | 0.57 | *Waldprofil Rooseveltpl. | |||
| 21 | 1.52 | 25.85 | 1.42* | 0.12 | *Waldprofil Waldmatt | ||||
| 22 | 12.59 | 15.37 | 4.31 | ||||||
| 23 | 23.77 | ||||||||
| 24 | 10.60 | 13.25 | 2.06* | 2.71 | 3.10 | *Flechtenversuchsfläche | |||
| 25 | 1.24 | 30.94 | |||||||
| 26 | 3.85 | 11.25 | 5.91 | 1.63 | 2.69 | ||||
| 27 | 6.42 | 1.05 | 16.67* | 0.39 | *waldgesch. Bestand | ||||
| 28 | 4.32 | 1.61 | 10.56 | 2.67 | 2.69 | 0.50 | |||
| 29 | 18.18 | 3.53 | 3.38 | ||||||
| 30 | 6.93 | 10.05 | 7.76* | *Wüstung Schnabelhöfe | |||||
| 31 | 39.42 | 1.96 | |||||||
| 32 | 5.57 | 0.44 | 2.24 | 2.21 | 0.28 | ||||
| 33 | 11.86 | 2.49 | 5.12 | 1.58 | |||||
| 34 | 4.01 | 3.62 | 0.38 | 4.95 | 2.46 | 0.81 | |||
| 35 | 10.89 | 5.82 | 1.43 | ||||||
| SwII | 166.81 | 59.49 | 196.94 | 28.46 | 27.95 | 18.17 | 22.42 | 14.54 | = 534.78 ha |
| 99 | 8.22 | Offenlächen | |||||||
| Sw tot. | 231.79 | 252.24 | 300.48 | 58.01 | 70.17 | 50.56 | 51.93 | 41.06 | = 1055.24 ha |
|
|
R | F | U | V | S | N | W | O | |
| Reser-
vat |
freie
Waldentw. |
Überfüh-
rung |
Sonder-
zone |
Sicher
heitsz. |
Nachbar-
schaftsz. |
Wald-
randz. |
Offen-
flächen |
Total
Sihlwald |
|
| nach Revieren | |||||||||
| Sihlwald I | 65.0 | 192.8 | 103.5 | 29.6 | 42.2 | 32.4 | 28.5 | 18.3 | 512.3 ha |
| 6.2 | 18.3 | 9.8 | 2.8 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 48.6 % | |
| Sihlwald II | 166.8 | 59.5 | 196.9 | 28.5 | 28.0 | 18.2 | 22.4 | 14.5 | 534.8 ha |
| 15.8 | 5.6 | 18.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 49.3 % | |
| ganzer Wald | 231.8 | 252.2 | 300.5 | 58.0 | 70.2 | 50.6 | 51.0 | 41.0 | 1055.3 ha |
| 21.9 | 23.9 | 28.5 | 5.5 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 100.0 % | |
| nach Entwicklungsstufen (%-Zahlen nur auf bewaldete Fläche bezogen) | |||||||||
| Jungwuchs/ | 6.5 | 7.6 | 50.2 | 2.6 | 9.6 | 4.2 | 3.8 | 84.5 ha | |
| Dickung | 0.6 | 0.7 | 5.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 8.3 % | |
| Stangenholz | 0.5 | 14.9 | 72.9 | 3.5 | 11.6 | 5.8 | 7.3 | 116.4 ha | |
| -.- | 1.5 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 11.5 % | ||
| schwaches | 0.1 | 10.7 | 16.0 | 0.2 | 2.7 | 1.0 | 3.2 | 33.9 ha | |
| Baumholz | -.- | 1.1 | 1.6 | -.- | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.4 % | |
| mittleres | 31.0 | 106.6 | 88.2 | 7.1 | 7.1 | 10.3 | 8.9 | 259.2 ha | |
| Baumholz | 3.1 | 10.5 | 8.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 25.6 % | |
| Altholz I | 57.5 | 64.6 | 55.1 | 31.5 | 20.2 | 15.9 | 12.4 | 257.2 ha | |
| 5.7 | 6.4 | 5.4 | 3.1 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 25.4 % | ||
| Altholz II | 84.4 | 9.4 | 9.8 | 5.5 | 11.1 | 3.6 | 6.0 | 129.9 ha | |
| 8.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 12.8 % | ||
| Altholz III | 4.4 | 3.1 | 6.8 | 7.4 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 26.7 ha | |
| 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 % | ||
| ungleichalt | 47.0 | 35.4 | 1.4 | 0.2 | 6.1 | 8.8 | 7.2 | 106.0 ha | |
| stufig | 4.6 | 3.5 | 0.1 | -.- | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 10.4 % | |
| nach Mischungsverhältnis (%-Zahlen nur auf bewaldete Fläche bezogen) | |||||||||
| > 90% Ndh | 2.0 | 5.5 | 53.2 | 1.7 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 88.8 ha | |
| 0.2 | 0.5 | 5.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 8.8 % | ||
| 50-90% Ndh | 11.2 | 33.4 | 92.8 | 21.3 | 12.8 | 6.1 | 11.3 | 188.9 ha | |
| 1.1 | 3.3 | 9.1 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 18.6 % | ||
| 50-90% Lbh | 80.2 | 72.6 | 77.6 | 10.5 | 26.9 | 11.3 | 11.2 | 290.3 ha | |
| 7.9 | 7.2 | 7.7 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 28.6 % | ||
| > 90% Lbh | 138.0 | 140.7 | 76.8 | 24.5 | 21.2 | 24.7 | 19.9 | 445.8 ha | |
| 13.6 | 13.9 | 7.7 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 44.0 % | ||
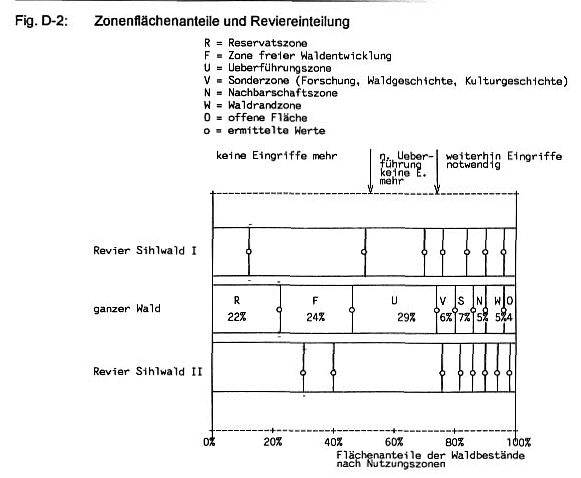
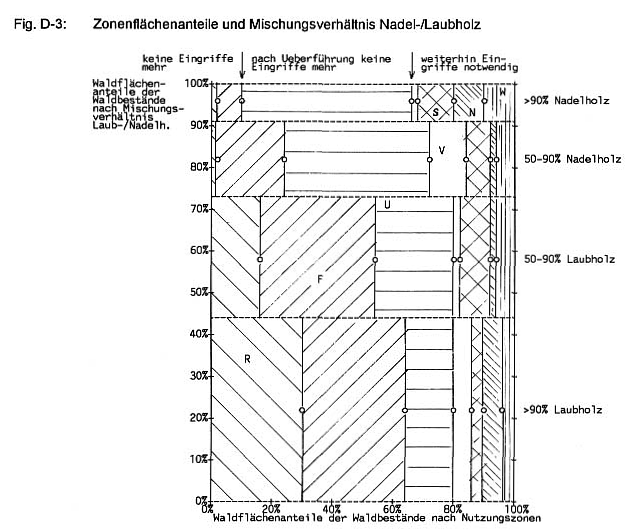 Fig. D-3: Zonenflächenanteile und
Mischungsverhältnis Nadel-/Laubholz
Fig. D-3: Zonenflächenanteile und
Mischungsverhältnis Nadel-/Laubholz
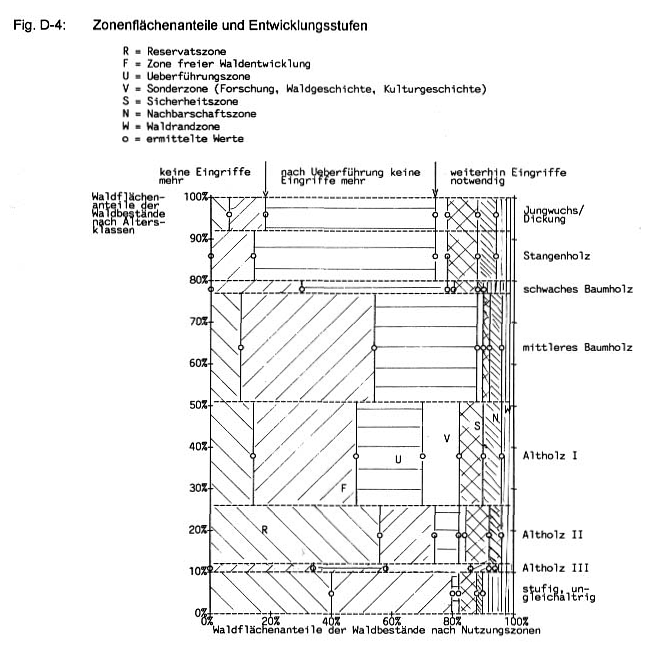
Für alle Waldbestände, in welchen Eingriffe
geplant sind, wurde basierend auf der Bestandeskarte ein Massnahmenplan
erstellt (vgl. Anhang). In diesem werden sieben Eingriffsarten unterschieden,
die im folgenden genauer umschrieben werden. Weiter enthält der Massnahmenplan
Angaben, in welchem Drittel der laufenden Planungsperiode die Massnahme
erfolgen soll.
. nichts machen (Beobachtung der weiteren Entwicklung)
. mittelwaldartig oder nach Gruppenplentersystem die Struktur aufbrechen
. nach bisheriger Auslesedurchforstung weiterbehandeln
Diese Möglichkeiten sind gutachtlich je nach Bestandesverhältnissen und in zufällig wirkender Art und Weise anzuwenden; im Mittel ist 35-45% des Zuwachses zu nutzen.
- In den über 60- bis 90-jährigen Beständen keine groben, die Bestandesstruktur aufbrechenden Massnahmen mehr, sondern sanfte bis mittlere Eingriffe; Entnahmen von höchstens 50% des Zuwachses.
- Letzte Eingriffe können auch in den 90- bis
120-jährigen Beständen stattfinden; es ist jedoch nicht mehr
als 25% des Zuwachses zur behutsamen Verbesserung der Struktur zu entnehmen.
. nichts machen (Beobachtung der weiteren Entwicklung)
. kleinflächig auf den Stock setzen (z.B. bei Reinbeständen mit standortsfremden Baumarten)
. mittelwaldartig oder nach Gruppenplentersystem die Struktur aufbrechen und standortsgerechte Baumarten fördern, konsequente Entnahmen zur Mischungsregulierung
. nach bisheriger Auslesedurchforstung weiterbehandeln; standortsgerechte Baumarten fördern, konsequente Entnahmen zur Mischungsregulierung
Diese Möglichkeiten sind gutachtlich je nach Bestandesverhältnissen und in zufällig wirkender Art und Weise anzuwenden; im Mittel ist 35-45% des Zuwachses zu nutzen.
- In den über 60- bis 90-jährigen Beständen keine groben, die Bestandesstruktur aufbrechenden Massnahmen mehr, sondern sanfte bis mittlere Eingriffe; Förderung standortsgerechter Baumarten; Entnahmen von höchstens 50% des Zuwachses.
- Letzte Eingriffe können auch in den 90- bis
120-jährigen Beständen stattfinden; es ist jedoch nicht mehr
als 25% des Zuwachses zur behutsamen Verbesserung von Struktur und Baumartenvertretung
zu entnehmen.
- Abklären, ob langfristig Massnahmen überhaupt notwendig sind und ob Gefährdung tatsächlich grösser als in bewirtschaftetem Wald ist
- Erhalten von Sicht- und Blendschutz gegen Waldinneres
- Ueberprüfung von Gesundheit und Standfestigkeit von exponierten Bäumen
- Fledermausbäume am Rand der Zone möglichst stehen lassen
- Eingriffe durch kant. Tiefbauamt im Dienste der
Verkehrssicherheit werden bis zu einer Tiefe von 10 Metern toleriert
- Es ist eine natürliche Ansamung und Verjüngung anzustreben. Je nach Waldgesellschaft soll sie einzel-, trupp- oder gruppenweise erfolgen.
- Auf Anpflanzungen wird verzichtet.
- Es ist eine Bestandeschronik, die mindestens einmal
jährlich nachgeführt wird zu führen. Sie soll die Art der
Nutzungen, Pflegemassnahmen, Erträge, Kostenberechnungen, Waldzustand,
Samenjahre und Zapfenproduktion enthalten.
- Entfernen von wenig standfesten Bäumen im Grenzbereich
- tolerieren von grenzüberschreitender Holznutzung
- Flechtenversuchsfläche (Abt.24): keine Eingriffe
- Schnabelhöfe (Abt.30): grundsätzlich keine Massnahmen der Waldgestaltung; im weitern:
. obwohl Biotop künstlich angelegt, kein Rückbau, da jede Veränderung des Reliefs vermieden werden sollte
. zusammen mit Archäologie abklären, ob Schutzmassnahmen erforderlich
- Risenbuck (Abt. 30): Der Orchideen-Föhrenwald am Risenbuck wurde vermutlich früher als 'Föhrenwiese' beweidet. Zur Erhaltung dieser seltenen, lichten Waldgesellschaft sollen bei Bedarf stark beschattende Einzelbäume entfernt werden
- Versuchsflächen ETH (Abt. 12,14): gemäss Anleitung ETH
- Versuchsflächen WSL (Abt. 12,13): gemäss Anleitung WSL
- Gehret'sches Vorwaldprinzip Abt.27 (vgl. Kap. B-3.4):
. Der Waldbestand ist als bewirtschafteter Wald zu erhalten, d.h. der Durchforstungsbetrieb ist wie bisher weiterzuführen.
. Auf einen Abtrieb der Bestände ist zu verzichten.
. Die bisherigen Wertträger Lärche, Föhre
und Fichte sind im gleichen Umfang beizubehalten, also keine Verschiebung
der Baumartenanteile anzustreben.
Naturnahe Waldränder brauchen Pflege, da sonst
die hochstämmigen Waldbäume über kurz oder lang die Strauch-
und Krautschicht verdrängen und gegenüber dem Freiland, das durch
künstliche Massnahmen waldfrei gehalten wird, einen schroffen Uebergang
bilden würden. Das Ziel der künftigen Waldrandpflege ist es,
den ökologischen Wert des Lebensraumes zu erhöhen, was durch
die Gestaltung von stufigen, strukturreichen Waldrändern erreicht
wird (vgl. Kapitel B-1.5.3 und C-3.8). Mit der Pflege können im Sinne
einer Optimierung je nach den lokalen Verhältnissen (anstossendes
Siedlungsgebiet, Kulturland o.a.) verschiedene Zielbilder angestrebt werden.
Die Waldrandpflege muss langfristig und zielgerichtet angelegt sein, es
kann Jahrzehnte dauern, bis sich eine vielfältige Strauchschicht ausbildet.
3.2.2 Prinzip der Waldrandpflege
Um eine ausgeprägte Strauchschicht zu erhalten,
muss für den Strauchsaum im Waldrandbereich Licht und Platz vorhanden
sein. Dazu müssen die Randbäume zurück gedrängt werden.
Ist ein Strauchsaum einmal ausgebildet, muss er mittels spezifischer Strauchpflege
erhalten werden, indem die Sträucher zurückgeschnitten oder auf
den Stock gesetzt und die aufkommenden Waldbäume entfernt werden.
Der Strauchsaum würde sonst innerhalb von wenigen Jahren, der natürlichen
Entwicklung entsprechend, von den Waldbäumen verdrängt. Es sind
ausschliesslich einheimische und standortgerechte Arten zu fördern.
Die Pflege ist regelmässig in Abständen von 6 bis 10 Jahren zu
wiederholen.
Ökologisch wertvolle Waldränder dürfen
nie auf ihrer ganzen Länge gleichzeitig gepflegt werden. Die Waldrandpflege
soll nur Abschnittsweise erfolgen. In Abschnitten von 20 - 50m Länge
soll ca. alle fünf Jahre eingegriffen werden, während in den
dazwischenliegenden Abschnitten mit einer zeitlichen Verschiebung von mindestens
drei Jahren gepflegt wird. Auf diese Weise bleibt immer ein Teil des Waldrandes
ungestört, so dass Tiere und Pflanzen ungestört überleben
können.
Bei jeder Waldrandpflege sollen markante Randbäume
erhalten bleiben, desgleichen Altholz und stehendes oder liegendes Totholz.
Bei der Pflege anfallendes Astmaterial wird teilweise zu Asthaufen aufgeschichtet.
Damit entstehen weitere interessante Lebensräume für Vögel,
Insekten und Kleinsäuger. Entlang von Strassen und Wegen sollen Dornsträucher
bevorzugt werden. Sie bieten der Fauna Schutz vor störenden Einflüssen.
Heute werden Waldränder oft maschinell geschnitten.
Das maschinelle Schneiden bewirkt lediglich ein horizontales Zurückschneiden
herauswachsender Äste bis auf 3-4 m Höhe. Da Sträucher und
Bäume häufig direkt an der Waldrandlinie stehen, werden die Äste
nahe am Stamm abgeschnitten, was unschön aussieht und die bestehende
Strauchschicht stark beeinträchtigt. Die künftige Waldrandpflege
kann nicht nur eindimensional, entlang der Waldrandlinie erfolgen, sie
muss viel mehr bis ins Innere des Waldrandbestandes eindringen.
3.2.3. Methoden der Waldrandpflege
Die Art und Weise, wie ein Waldrand gepflegt wird,
richtet sich vor allem nach dessen ökologischen Wert und nach dessen
Bestandesalter. Bei der Pflege ist an Ort und Stelle zu entscheiden, wie
ein Eingriff in die Waldrandzone aussehen soll. Um eine Vorstellung möglicher
Waldrandeingriffe zu bekommen, werden die, im Zusammenhang mit der Waldrandkartierung
auf dem Zürich- und Adlisberg beschriebenen Pflegemethoden angegeben
(Christen, 1993):
1. BS: 1. Baumschicht (Bäume >
15m), 2. BS: 2. Baumschicht (Bäume 5-15m), ST: Strauchschicht, WR:
Waldrand, R: Zurückschneiden, X: Fällen
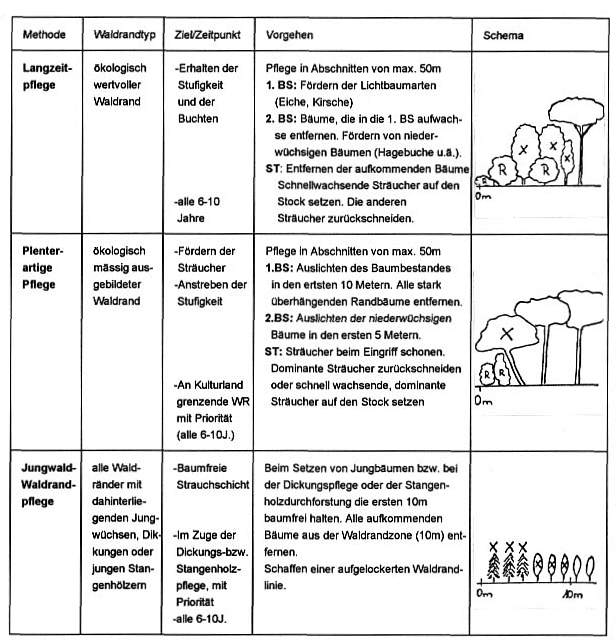
1. BS: 1. Baumschicht (Bäume >
15m), 2. BS: 2. Baumschicht (Bäume 5-15m), ST: Strauchschicht, WR:
Waldrand, R: Zurückschneiden, X: Fällen
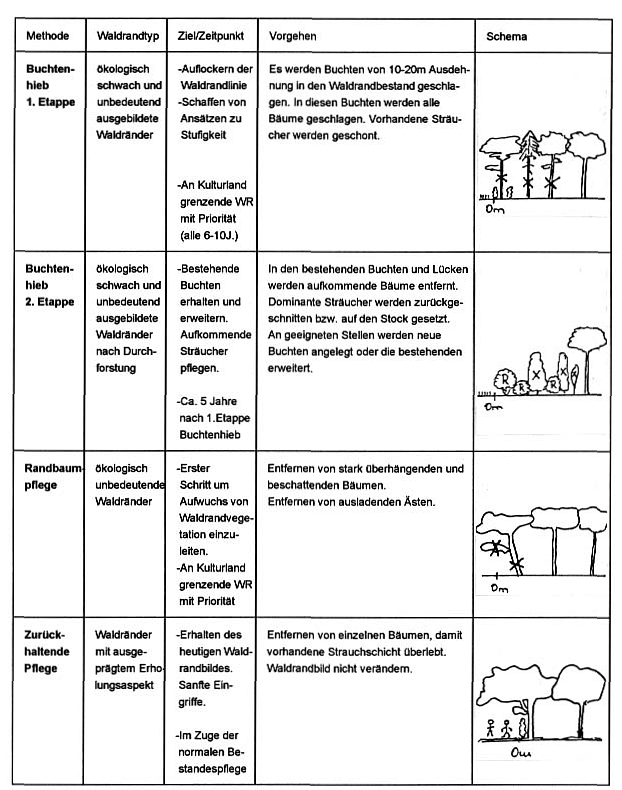
Für die Waldränder des Forstreviers Zürichberg/Adlisberg
wurde aufgrund der Waldrandkartierung eine relativ genaue Abschätzung
des jährlichen Aufwandes für die Waldrandpflege vorgenommen (Christen
1993). Es wurde im folgenden versucht, die Waldrandkartierung des Sihlwaldes
(BGU, 1986) an die dort gemachten Beschreibungen und Grundlagen anzupassen
(vgl. Plan im Anhang). Für ein detailliertes Bild sowie für die
Erstellung eines Massnahmenplanes müssten die Waldränder des
Sihlwaldes neu aufgenommen werden. Die folgende Zusammenstellung der Waldrandsituation
im Sihlwald und die Aufwandabschätzung beziehen sich nur auf die im
Zonenplan als Waldrandzone bezeichneten Waldränder.
JU: Jungwuchspflege BU1: Buchtenhieb, 1. Etappe
RB: Randbaumpflege BU2: Buchtenhieb, 2. Etappe
ZR: Zurückhaltende Pflege
| Kriterien/
Massnahmen |
Bewertung/
Einteilung |
Lauf-
meter |
Anteil an
Ges. länge |
mit Prio-
rität |
ohne Priorität |
| Waldrand total | 16'750 | 100% | 11300 | 5450 | |
| ökologischer
Wert (gem. BGU, 86) |
wertvoll | 3780 | 22,6% | (nicht
ausge- wertet) |
(nicht
ausge- wertet) |
| mässig | 8720 | 49,4% | |||
| schwach | 1960 | 11,7% | |||
| unbedeutend | 2740 | 16,4% | |||
| Umgebung
(gem. Karte) |
Kulturland | 10900 | 65,1% | (nicht
ausge- wertet) |
(nicht
ausge- wertet) |
| Strasse, Zaun,... | 5400 | 32,2% | |||
| Bauten | 450 | 2,7% | |||
| Erholungs-
wert |
ausgeprägt | 700 | 4,2% | (nicht
ausge.) |
(nicht
ausge.) |
| Pflegemethoden
(grobe Schätzungen) |
LA | 3800 | 22,7% | 3800 | |
| PLE | 5500 | 32,8% | 3000 | 2500 | |
| JU | 2500 | 14,9% | 2500 | ||
| BUI | 3200 | 19,1% | 2000 | 1200 | |
| RB | 1000 | 6,0% | 1000 | ||
| ZR | 750 | 4,5% | 750 |
Ausgehend vom Aufwand für die einzelnen Pflegemethoden
(vgl Tabelle D-13) und einem 6 jährigen Pflegerhythmus für Waldränder
mit Priorität und einem 10 jährigen Rhythmus für jene ohne
Priorität müssen jährlich 2425m Waldrand mit einem Aufwand
von 1066h pro Jahr gepflegt werden (Tabelle D-14).
| Pflegemethode: |
für 10 Laufmeter und 15m Eingriffstiefe: |
| Langzeitpflege (LA) |
|
| Plenterartige Pflege (PLE) |
|
| Jungwald-Waldrandpflege (JU) |
|
| Buchtenhieb (BUI + BUII) |
|
| Randbaumpflege (RB) |
|
| Zurückhaltende Pflege (ZR) |
|
| jährlicher Aufwand in m/j | 1880 | 545 | 2425 | |||
| jährlicher Aufwand in h/j | 834 | 323 | 1066 | |||