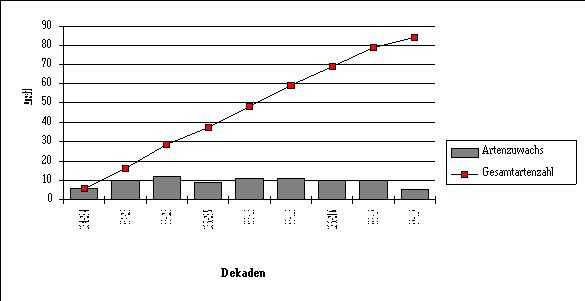
Das vorliegende Inventar der während des Feldversuches gesammelten Fliegen ist eine Synthese aus den Fallen- und den Kescherfängen (vgl. Tab. 7). Es enthält die vollständige Artenliste ohne quantitative Angaben. Diese sind zu Beginn der Kapitel 4.2.1. und 4.3.1. in den Tabellen 8 und 11 aufgeführt. Dafür wurde das biologische Wissen über die einzelnen Arten und Familien anhand der vorhandenen Literatur zusammengestellt.
Für die folgende Zusammenfassung der Biologie der einzelnen Arten wurde auf die Werke von BRAUNS (1991), CHANDLER (1973), FAGER (1968), FERRAR (1987), JACOBS & RENNER (1988), PERRY & STUBBS (1976), WALLACE (1953) und TESKEY (1976) zurückgegriffen. Weitere Angaben zu den Lebensweisen wurden den verschiedenen Bestimmungswerken (vgl. Spalte 12, Tab. 7) entnommen.
Insgesamt konnten 158 Arten und 11 Gattungen aus 29 Familien bestimmt werden. Dazu wurden drei Familien aufgeführt, aus denen keine Artbestimmungen vorliegen (Phoridae, Sphaeroceridae, Tachinidae).
Das Wissens zur Biologie der einzelnen Gruppen ist oft sehr gering, so dass nicht alle Taxa eindeutig zu den Totholz nutzenden Diptera gestellt werden konnten. Auch über die Nahrung ist oft so wenig bekannt, dass nur Mutmassungen angegeben sind (z.B. bei den meisten Vertretern der Empidoidea). In den meisten Fällen ernähren sich die Larven wahrscheinlich von anderen Insektenlarven oder weiteren holzbesiedelnden Wirbellosen.
Arten, die sich von Baumsaft ernähren, wurden zu den phytophagen Organismen gestellt. Mulm- oder Moder-Fresser, also eigentliche xylophage Tiere, wurden bei den saprophagen Insektenlarven eingeteilt. Koprophage Arten wie z.B. Rhingia campestris (Syrphidae) haben nichts mit Totholz zu tun, da sie ihre Larvenstadien in Dung von Wirbeltieren verbringen und nur zufällig auf den entsprechenden Strukturen zu finden sind.
Vom 19.4. bis zum 7.7. wurden total 491 Fliegen-Individuen in den Emergenzfallen gefangen (Tab. 8). Davon wurden 10 Ex. nur bis zur Familie bestimmt (Sphaeroceridae und Tachinidae) und 19 Ex. (alles Weibchen) nur auf Gattungsniveau. Die restlichen 462 Individuen gehörten 77 Arten an. Als einzige Familie der Brachycera wurden die Phoridae aufgrund der erheblichen Bestimmungsschwierigkeiten ganz weggelassen.
In den untersten zwei Zeilen der Tabelle sind Individuen- und Artenzahl pro Falle aufgeführt. Die Verteilung der Tiere ist sehr unregelmässig und nur gerade 2 Fallen (A/B2 und B/F2) erreichten über 50 Ex. Die restlichen blieben unter dieser Marke und schwankten zwischen 13 Ex. (B/B1) und 42 Ex. (B/F1). Das schlechteste Resultat stammt aus C/F1 mit 7 Ex.
Die Falle A/B2 wies am meisten Arten (20) auf. Daneben enthielten A/F2 und B/F1 je 19 Arten. In C/B2 wurden lediglich 6 Arten gefunden. Ältere Zerfallsstadien werden demnach von den Imagines bevorzugt zur Eiablage aufgesucht und sind qualitativ und quantitativ herausragend.
Die Sammelperiode (Abb. 12 und Abb. 13) wurde in Dekaden eingeteilt (anstelle der Exkursionsdaten), damit zeitlich nahe beieinander liegende Exkursionen nicht so stark ins Gewicht fallen. Die Zahl der neuen Arten resp. Individuen innerhalb dieser Zeitspanne wurde aufsummiert.
Während der ganzen Untersuchungsperiode verlief die Entwicklung der Artenzahl ziemlich gleichmässig (Abb. 12). Zu Beginn schlüpften relativ wenige Arten. Ab dem 23.4. nahm der Artenzuwachs zu, schwächte sich nach Mitte Mai ein wenig ab und verlief stetig bis Ende Juni. Erst nach Anfang Juli fand eine Abnahme der Schlüpfaktivität statt. Die Exkursionen vom 25.4. und 28.4. brachten keine neuen Arten. Am 28.5. waren 50 % der Arten gesammelt.
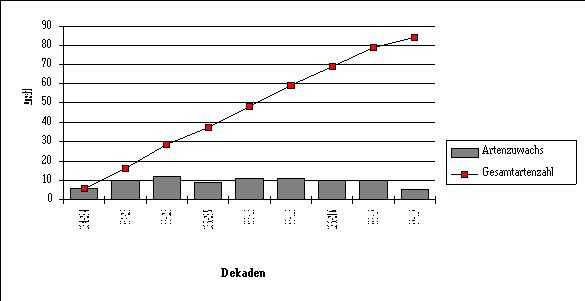
Abb. 12: Entwicklung der Artenzahl der Fallenfänge in Dekadensummen während der Untersuchungsdauer vom 13.4.-7.7.
Die Entwicklung der Individuenzahl (vgl. Abb. 13) verlief ähnlich wie die Artenzahl, zeigte aber Ende April / Anfang Mai ein deutlicheres Maximum. Ab dem 22.4. erfolgte ein sprunghaftes Ansteigen der Individuenzahl durch das Schlüpfen der massenhaft auftretenden Euthyneura gyllenhali und Rhamphomyia pilifer. Nach dem 12.5. nahm der Zuwachs rund um die Hälfte des Maximalwertes wieder ab, pendelte sich zwischen 43- 47 Ex. / Dekade ein und verlief stetig bis zur zweitletzten Dekade. In der letzten Dekade des Feldversuchs konnten schliesslich nur noch 34 Ex. gefangen werden. Nach einem gutem Drittel der Untersuchungsperiode am 16.5. waren bereits 50 % der Tiere geschlüpft.
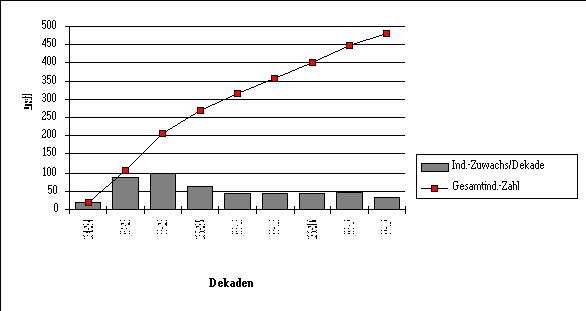
Abb. 13 : Entwicklung der Individuenzahl der Fallenfänge in Dekadensummen während der Untersuchungsdauer vom 13.4.-7.7.
Die Zunahme der Gesamtzahlen sowohl der Arten als auch der Individuen nimmt gegen Ende des Versuches nur schwach ab, so dass bei längerer Untersuchungsdauer mit einem weiteren Zuwachs zu rechnen gewesen wäre.
Wie bereits erwähnt wurden wenige Arten extrem häufig gefangen (Abb. 14). Der grösste Teil (36 Arten) kam aber nur in Einzelexemplaren vor. Diese Verteilung entspricht einer logarithmischen Serie und ist typisch für heterogen verteilte Tiergemeinschaften mit wenigen dominanten Arten (KREBS, 1987).
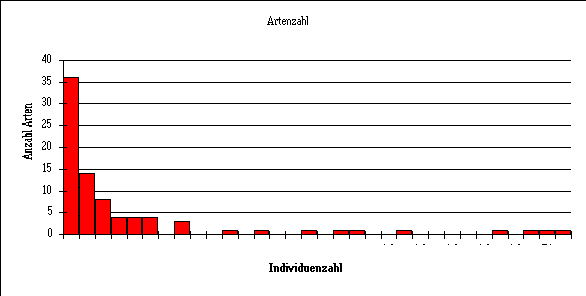
Abb. 14: Zusammenhang zwischen Arten- und Individuenzahl der in den Emergenzfallen gefangenen Dipteren.
Lediglich zehn Arten wurden in mehr als 10 Ex. gesammelt. Mit einem Anteil von 20,4 % (100 Ex.) ist Euthyneura gyllenhali die häufigste Diptera, die gefangen wurde. Tabelle 9 gibt einen Überblick über die dominierenden 10 Arten, die zusammen 62.9% aller Exemplare ausmachen.
Tab 9:. Die häufigsten 10 Arten der in den Emergenzfallen gefangenen Dipteren
| Art | Anzahl | am Total | mit Max | am Art-Total | |
| Rhamphomyia umbripennis | |||||
| Trichopeza longicornis | |||||
| Medetera tristis | |||||
| Clusiodes alminana | |||||
| Hybos femoratus | |||||
| Hybos culiciformis | |||||
| Oedalea zetterstedti | |||||
| Dolichocephala guttata | |||||
| Scaptomyza graminum | |||||
| Rhamphomyia pilifer | |||||
| Total |
Die Auftrennung in Familien verdeutlicht das dominante Auftreten von Arten aus den Hybotidae und Empididae, die zusammen bereits 60 % aller Individuen ausmachen (vgl. Tab. 10). Keine weitere Familie erreichte sonst die 10 %-Marke. Von den 83 Arten bzw. Gattungen der Fallenfänge gehören 21 Taxa den Hybotidae und 10 Taxa den Empididae an.
Die Hybotidae sind die dominierende Gruppe (vgl. Tab. 10). Die höchsten Anteile wurden in den alten Strünken (A) gefunden (max. 64.5 % in A/F2). Jüngere Strünke sind offensichtlich weniger attraktiv und wiesen grosse Schwankungen in den Werten auf, die zwischen 0 % und 58.2 % (B/F2) lagen. Total gehörten 40 % aller Tiere den Hybotidae an.
Empididae sind in allen jungen Stubben (C) gefunden worden (10-36.8 % aller Fliegen). Von den mittleren Abbaustadien (B) wurden nur Fichten- und Ahornstrünke besiedelt. Bei den ältesten Stubben zeigten sie hingegen eine Bevorzugung der Buche und erreichten in A/B2 mit 37.9 % ihr Maximum. Sie stellten ein Fünftel aller Tiere.
Vertreter aus der Familie Muscidae machen knapp einen Zehntel am Gesamttotal aus und zeigen ein Vorliebe für alte und mittlere Strünke. Auf jungem Laubholz kommen sie nicht vor. Dolichopodidae und Rhagionidae erreichen rund 6.5 % und zeigen kein spezielle Tendenz. Alle anderen Familien tragen noch 17.9 % zum Gesamtergebnis bei.
Tab. 10: Prozentualer Anteil der einzelnen Familien in den Emergenzfallen und am Gesamttotal. Der Durchschnitt ist für die 14 Fallen berechnet worden. Abkürzungen sind in Kap. 3.2.2. erklärt.
| FAMILIE | ||||||||||||||||
| Dolichopodidae | 14.3 | 2.3 | 0 | 6.5 | 5.6 | 0 | 11.1 | 7.1 | 5.7 | 10 | 5.3 | 28.6 | 11.8 | 5.9 | ||
| Empididae | 21.4 | 37.9 | 11.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 26.2 | 19.1 | 10 | 36.8 | 14.3 | 11.8 | 11.8 | ||
| Hybotidae | 42.9 | 46 | 44.4 | 64.5 | 16.7 | 30.8 | 27.8 | 19 | 58.2 | 0 | 42.1 | 0 | 35.3 | 5.9 | ||
| Muscidae | 10.7 | 5.8 | 27.8 | 6.5 | 16.7 | 15.4 | 5.6 | 9.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 23.5 | ||
| Rhagionidae | 0 | 4.6 | 5.6 | 3.2 | 0 | 7.7 | 5.6 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | 15.8 | 14.3 | 29.4 | 64.7 | ||
| Sarcophagidae | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | ||
| Sciomyzidae | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 7.7 | 11.1 | 16.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stratiomyidae | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Restl. Familien | 10.7 | 2.3 | 5.6 | 12.9 | 27.8 | 38.5 | 16.7 | 9.5 | 0.7 | 50 | 0 | 28.6 | 5.9 | 23.5 |
Wie aus Abb. 15 hervorgeht, sind die Arten, deren Larven räuberisch leben, am besten vertreten. Der Anteil karnivorer Organismen macht bis zu 80 % der in einer Falle gefangenen Dipteren aus und erklärt sich durch die Dominanz der Empidoidea. Nur C/A2 und C/B2 liegen unter der 40 %-Marke und weisen dafür einen höheren Anteil (50 %) saprophager Larven auf. Dipteren mit parasitischen oder parasitoiden Larven wurden in allen Fallen gefunden ausser in C/F1 und C/F2. Ihr Anteil bewegt sich zwischen 5 % und 30 %. Auf allen Strünken kamen saprophage Lebewesen vor, die sich von Mulm, zerfallendem Holz und Moder ernähren. Ihr Anteil an den gefangenen Arten gleicht demjenigen der Parasiten und beträgt zwischen 5 und 30 %. In C/A2 und C/B2 wurden sogar 50 % ermittelt.
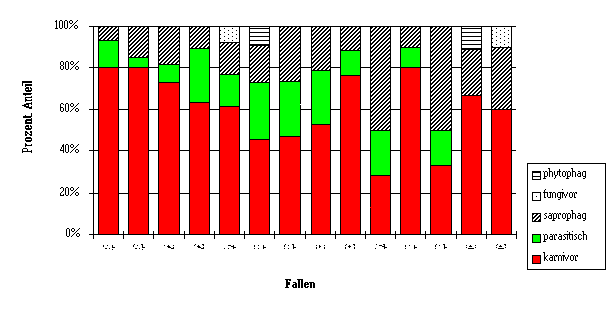
Abb. 15: Prozentualer Anteil der verschiedenen Ernährungstypen der in den Fallen gefangenen Dipteren.
Fungivore und phytophage Arten spielen eine untergeordnete Rolle. Pilzfresser kamen nur in B/A1 und C/F2 vor, phytophage Fliegenlarven, die sich von Algen und Bakterien ernähren, in B/B1 und C/F1. Die koprophage Scatophaga stercoraria (Scatophagidae) hat nichts mit Totholz zu tun und stammt sicher aus der Bodenfauna (nicht in Abb. 15 aufgeführt).
Mit Hilfe des unter Kap. 3.4.1. bezeichneten Programms wurden die Faunen der verschiedenen Fallen miteinander verglichen. Daneben wurden auch die Arten auf ihr ökologisches Verhalten hin mit dem gleichen Verfahren einer Cluster-Analyse unterzogen, um eventuelle Rückschlüsse über ihre Habitats- und Brutplatzpräferenzen ziehen zu können.
Die Cluster-Analyse für die Emergenzfallen ergibt das in Abb. 16 dargestellte Dendrogramm. Die Strünke des Alterstadiums A (³10 Jahre) und B/F2 sind untereinander relativ ähnlich. Die restlichen Stadien B und C sind davon deutlich abgetrennt. Eine zweite Gruppe ist um die Fallen C/F2 bis C/A2 zu erkennen. Die Korrelationskoeffizienten liegen aber im Bereich zwischen 0.3 und 0.6, d.h. die Artzusammensetzungen der einzelnen Fallen sind sehr unterschiedlich. Die jüngsten Buchenstrünke (B/B1, B/B2 und C/B2) sind untereinander und mit den anderen Wurzelstöcken kaum verwandt. Sie weisen einen geringen Korrelationskoeffizienten auf.
A B B I L D U N G (in Arbeit) Abb. 16: Dendrogramm zum Vergleich der Artidentitäten der untersuchten Baumstrünke (zur Berechnung vgl. Kap. 3.4.1.)
Die Ordinationsrechnung (Abb. 17) ergibt ein ähnliches Bild und stützt damit die Cluster-Analyse. Im negativen x- und y-Bereich
A B B I L D U N G (in Arbeit) Abb. 17: Ordination der Fallen zum Vergleich der Baumstrünke
Daraus lässt sich folgern, dass für die meisten Insektenarten die Baumart unwichtig ist. Offenbar spielen Struktur und Zerfall des Strunkes oder Mikroklimaparameter, die in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt wurden, eine grössere Rolle. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Stichprobe zu klein ist. Es handelt sich hier um Tendenzen.
Mit dem in Kap. 3.4.1. angegebenen Verfahren wurden auch die Arten auf ihr ökologisches Verhalten hin verglichen. Aus dem Dendrogramm in Abb. 18 kann eine Gruppe von Arten erkannt werden, die sich aus Rhaphium sp. (Dolichopodidae), Leptopeza borealis (Hybotidae), Euthyneura gyllenhali (Hybotidae) und Coenosia sallae (Muscidae) zusammensetzt. Der Korrelationskoeffizient für diese Arten liegt sehr hoch, da sie in grösserer Zahl aus B/F2 gesammelt wurden. In geringem Ausmass wurden sich auch auf den ältesten Strünken von Buche und Fichte gefunden. Weitere Arten, die dieser Gruppe nahe stehen, sind Trichopeza longicornis (Empididae) und Rhamphomyia pilifer (Empididae). Sie zeigen ein ähnliches ökologisches Verhalten bezüglich der Brutplatzwahl, besiedeln aber auch jüngere Zerfallsstadien als die anderen Arten. R. pilifer nutzte die Strünke aller drei Baumarten, T. longicornis nur die Fichte.
A B B I L D U N G (in Arbeit) Abb. 18: Dendrogramm zum Vergleich des ökologischen Verhaltens der Fliegen im Sihlwald. Die Artnamen sind abgekürzt (erste drei Buchstaben des wissenschaftlichen Namens).
Ein zweiter Cluster bildet sich mit Rhamphomyia umbripennis (Empididae), Oedalea stigmatella und Euthyneura myrtilli (beide Hybotidae). Letztere schlüpften grösstenteils, die erstgenannte Art hingegen ausschliesslich aus Buchenstrünken. Alle drei Arten kamen v.a. in alten Wurzelstöcken vor, besiedelten aber auch die mittleren und jungen Stadien.
Daneben zeigen Xylota sylvarum (Syrphidae) und Beris chalybata (Stratiomyidae) eine gute Korrelation und schlüpften v.a. aus dem Bergahornstrunk C/A2. Lonchaea fugax (Lonchaeidae) ist annähernd an diese Gruppe angegliedert und wurde nur auf C/A2 gesammelt.
Von den in Tab. 9 aufgeführten Arten ist nur Rhagio lineola (Rhagionidae) nicht in einer der Hauptgruppen (Fichten- resp. Buchen-Cluster) zu finden und ist überhaupt nicht mit diesen korreliert. Offenbar zeigt diese Art ein sehr unterschiedliches ökologisches Verhalten und besiedelte alle Altersstadien von Buchen und Fichten, hatte aber einen Schwerpunkt auf den jüngsten Fichtenstrünken.
Die restlichen Arten, Heteronychia depressifrons (Sarcophagidae), Hybos femoratus (Hybotidae) sowie Sciapus platypterus (Dolichopodidae), haben untereinander und zu den restlichen Arten einen geringen Korrelationskoeffizienten. Sie sind nicht miteinander vergleichbar und weisen unterschiedliche ökologische Ansprüche auf. H. depressifrons lebt als Larve parasitisch, die beiden anderen Arten karnivor.
Rhamphomyia pilifer und Euthyneura gyllenhali waren bereits im ersten Drittel des Versuchs sehr zahlreich (vgl. Abb. 19). Erstere erreichte bereits am 29.4. den Median des Schlüpfens, letztere 5 Tage später. Neben einem Hauptgipfel des Erscheinens sind bei beiden Arten deutlich kleinere Nebengipfel zu unterscheiden, die zwischen dem 13.-17.5. am stärksten ausgeprägt waren. E. gyllenhali wurde in einem grossen zeitlichen Abstand Anfang Juni nochmals gesammelt, was auf eine mögliche zweite Generation schliessen lässt.
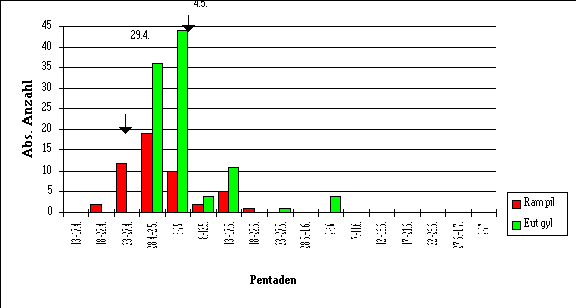
Abb. 19: Phänologie des Erscheinens von Euthyneura gyllenhali (weisse Balken) und Rhamphomyia pilifer (schwarz)
Erst in der letzten Hälfte der Untersuchungsperiode traten Rhagio lineola und Tachypeza nubila auf (Abb. 20). Letztere begann Anfang Juni mit dem Schlüpfen, die erstgenannte Art gegen Mitte des Monats. Beide wiesen eine leicht zweigipflige Phänologie auf. Der Median fiel bei T. nubila, die für den ganzen Juni typisch war, auf den 14.6., bei R. lineola auf den 24.6.
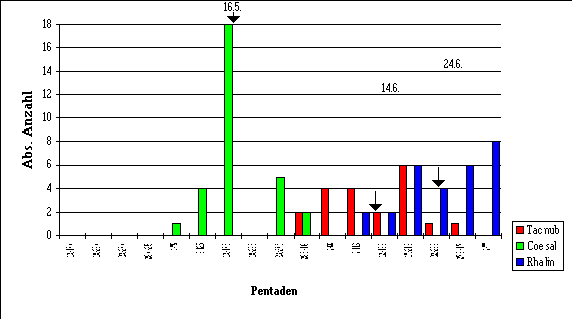
Abb. 20: Phänologie des Erscheinens von Coenosia sallae (weisse Balken), Rhagio lineola (grau) und Tachypeza nubila (schwarz).
Zwischen diesen Extremen lag Coenosia sallae, deren Median auf den 16.5. zu liegen kam und ein eingipfliges Auftreten zeigte. Die Art war charakteristisch für den ganzen Monat Mai. Nach einem Maximum Mitte des Monats lief die Schlupfaktivität bis Anfang Juni wieder aus.
Im zweiten Teil der Arbeit wurden aus Kescherfängen 624 Dipterenindividuen bestimmt, die 122 Arten bzw. Gattungen und 17 Familien angehörten (vgl. Tab. 11). Auf die zeitaufwendige Determination der Calayptrata und der meisten Acalyptrata wurde verzichtet. Ebenso konnten die schwierig zu bestimmenden Dolichopodidae nicht vollständig bearbeitet werden. In Tab. 11 sind die Quantitäten der Arten auf den einzelnen Strukturen und Flächen sowie die Summen und das Gesamttotal aufgeführt.
Hybotidae und Empididae (je 24 Arten bzw. Gattungen) stellen hier die meisten Tiere mit 117 bzw. 206 Ex. Weitere gut vertretene Familien sind Dolichopodidae [pp.] (8 Arten, 4 Gattungen und 65 Ex.), Syrphidae (18 Arten, 63 Ex.) und Drosophilidae (12 Arten, 55 Ex.).
Von den Flächen schnitt F3 mit 148 Individuen am besten ab, F2 am schlechtesten mit 83 Individuen. Die Strukturen lagen alle im Bereich zwischen 37 und 53 Ex. mit maximal 59 Ex. auf S7 und minimal 24 Ex. auf S5.
Die mit Abstand häufigste Art war Rhamphomyia umbripennis (Empididae), die auf allen Flächen und Strukturen in total 80 Individuen gesammelt wurde. Maximal erzielte die Art 24 Ex. auf F1 (vgl. Tab. 12). Weitere auffällige Fliegenarten waren Trichopeza longicornis (Empididae) und Medetera tristis (Dolichopodidae), von denen 22 resp. 21 Ex. bestimmt wurden. Als einzige Acalyptrata trat Clusiodes albmana (Clusiidae) relativ stark in Erscheinung und erreichte 20 Ex.
Tab. 12: Die häufigsten zehn Arten aus den Kescherfängen.
F = Fläche; S = Struktur
ART Total F / S %-Anteil
Anzahl %-Anteil mit Max Anzahl am Art-Total
Rhamphomyia umbripennis 80 12.8 F1 24 30
Trichopeza longicornis 22 3.5 F3 8 36.4
Medetera tristis 21 3.4 F3 8 38.1
Clusiodes albimana 20 3.2 F1 / S6 6 30
Hybos femoratus 20 3.2 F3 7 35
Hybos culiciformis 19 3.0 F1 8 42.1
Oedalea zetterstedti 19 3.0 F2 6 31.6
Dolichocephala guttata 18 2.9 S3 7 38.9
Scaptomyza graminum 14 2.2 F3 / S7 4 28.6
Rhamphomyia pilifer 13 2.1 F3 5 38.5
Total 246 39.3 83
Scaptomyza graminum (Drosophilidae) (14 Ex.) und Rhamphomyia pilifer (13 Ex.) konnten bereits deutlich weniger oft gefangen werden.
Aus Tab. 12 ist wieder die Dominanz der Empididae und Hybotidae zu erkennen. Lediglich Medetera tristis, Clusiodes albimana und Scaptomyza graminum gehören nicht zu diesen beiden Familien. Allerdings konnte nur für R. umbripennis mehr als 10 % errechnet werden. Alle anderen Arten liegen unter der 5 %-Marke.
Aus Abb. 21 kann ein ähnlicher Verlauf wie in Abb. 14 (Kap. 4.2.3.) für die Häufigkeitsverteilung der Fallenarten herausgelesen werden. Von 47 Arten liegen nur Einzelexemplare vor, von 17 Arten wurden je 2 Ex. bestimmt. Danach läuft die Kurve flach aus und zeigt denselben exponentiellen Verlauf wie Abb. 14. Wenige Arten dominieren zahlenmässig über eine Vielzahl von anderen, selteneren Insektenarten (vgl. KREBS, 1987).
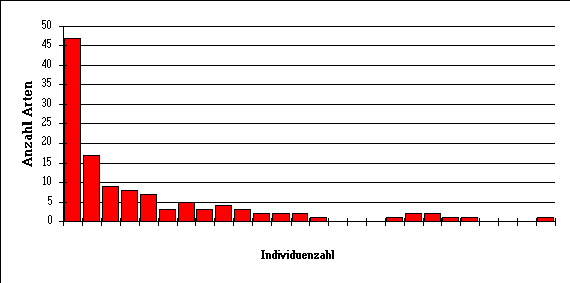
Abb. 21: Zusammenhang zwischen der Arten- und der Individuenzahl der mit dem Kescher gesammelten Dipteren im Sihlwald.
Für dieses Kapitel wurden nur Familien mit fünf oder mehr bestimmten Arten miteinbezogen. Es handelt sich nur um einen qualitativen Vergleich.
Von den insgesamt 169 Taxa sind nur gerade 34 Arten und 4 Gattungen mit beiden Methoden festgestellt worden. Dies entspricht einem knappen Viertel (22.5 %). Drosophilidae und Syrphidae zeigen überhaupt keine Übereinstimmung zwischen Fallen- und Kescherfängen (vgl. Tab. 13). Bei den Dolichopodidae und den Empididae lagen die Überschneidungen bei 13.3 % bzw. 29.2 %, was v.a. bei ersterer ein niedriger Wert ist. Rhagionidae und Clusiidae hatten mit je 60 % am meisten gemeinsame Arten. Ebenfalls über die Hälfte gemeinsame Arten wiesen Hybotidae mit 53.6 % auf. Stratiomyidae zeigten mit 40 % eine ziemlich gute Deckung.
Tab. 13: Vergleich der mit den verschiedenen Sammelmethoden erreichten
Übereinstimmungen der bis auf die Art bestimmten Familien.
F = Falle, Fl = Fläche, Str = Struktur
Familie Anz. Arten Gemeinsame Arten
total in F Fl./Str absolut in %
Clusiidae 5 4 4 3 60
Dolichopodidae 15 8 9 2 13.3
Drosophilidae 12 0 12 0 0
Empididae 24 9 22 7 29.2
Hybotidae 28 20 23 15 53.6
Lonchaeidae 6 1 5 1 16.7
Rhagionidae 5 3 5 3 60
Stratiomyidae 5 2 5 2 40
Syrphidae 17 2 15 0 0
Ausser bei den Clusiidae wurde mit Handfängen die höhere Anzahl verschiedener Arten gesammelt. Im Extremfall wie bei den Drosophilidae wurden sogar alle Arten mit dem Kescher festgestellt. Bei den Syrphidae wurden von den 17 Arten nur gerade zwei in den Fallen nachgewiesen. Von dieser Familie wurden mit dem Kescher auch zahlreiche Arten gesammelt, die aphidivor oder koprophag sind und mit Totholz in keiner Verbindung stehen (vgl. Tab. 7).
Von den häufigsten zehn Fallenarten wurden alle ausser Coenosia sallae auch mit dem Kescher nachgewiesen (vgl. Tab. 14). Zwischen den Resultaten von Kescher- und Fallenfängen sind oft grosse quantitative Unterschiede festzustellen.
Tab. 14: Die zehn häufigsten Arten aus den Fallen im Vergleich mit den Kescherfängen. ; fettgedruckte Arten sind ebenfalls in Tab. 15 zu finden. Erklärungen zu den Abkürzungen s. Tab. 13. Art Anz. F. Rang F. Anz Str. /Fl. Rang Str/Fl. Euthyneura gyllenhali 100 1 2 - Rhamphomyia pilifer 51 2 13 10 Coenosia sallae 30 3 0 - Rhagio lineola 28 4 4 - Tachypeza nubila 22 5 2 - Oedalea stigmatella 19 6 3 - Trichopeza longicornis 18 7 22 2 Rhamphomyia umbripennis 16 8 80 1 Leptopeza borealis 13 9 1 - Beris chalybata 11 10 1 -
Mit dem Kescher wurden meist andere Strukturen abgesucht, als dies mit den Emergenzfallen möglich gewesen ist. Die drei Arten, die in beiden Auswahlen in den häufigsten zehn Arten zu finden sind, dürften bei der Wahl des Brutplatzes weniger spezialisiert sein oder sich länger in dessen Nähe aufhalten. Sie zeigen eine Vorliebe für schattige, feuchte Plätze. Die Imagines der Gattung Rhamphomyia ernähren sich karnivor oder sind Blütenbesucher (BARTAK, 1982).
Dolichocephala guttata und Scaptomyza graminum konnten nur von Hand in relativ grosser Zahl gefangen werden (vgl. Tab. 15). Erstere hat eine starke Bindung an feuchte, schattige Stellen (COLLIN, 1961), letztere ist ein Grasminierer und ist nicht auf Totholz angewiesen (BÄCHLI & BURLA, 1985).
Tab. 15: Die zehn häufigsten Kescherarten im Vergleich mit den Resultaten
aus den Emergenzfallen (Erklärungen s. Tab. 13)
Art Anz. Rang Anz.F. Rang F.
Str./Fl. Str./F.
Rhamphomyia umbripennis 80 1 16 8
Trichopeza longicornis 22 2 18 7
Medetera tristis 21 3 5 -
Clusiodes albimana 20 4 1 -
Hybos femoratus 20 5 6 -
Hybos culiciformis 19 6 3 -
Oedalea zetterstedti 19 7 2 -
Dolichocephala guttata 18 8 - -
Scaptomyza graminum 14 9 - -
Rhamphomyia pilifer 13 10 51 2