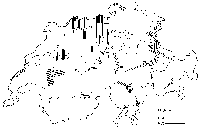Nach den Besprechungen mit Prof. Dr. Itten und M.
Christen setzten wir uns folgende Ziele:
Abkürzungen
| EAFV | Eidgenössische Anstalt für das forstliche Versuchswesen |
| IKT | Institut für Kommunikationstechnik, ETH Zürich |
| IR | Infrarot |
| KSL | Koordinationsstelle für Luftaufnahmen |
| LFI | Landesforstinventar |
| WSL | Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (früher EAFV) |
a) Beschaffung der Liste der vorhandenen Luftbilder bei der Landestopographie
Wir stellten folgende Fragen:
Die erhaltenen Angaben der schweizerischen Landestopographie
sind im Kapitel 4.4 aufgelistet.
Nach der Beantwortung dieser Fragen wollten wir Luftbilder
über eine möglichst grosse Zeitspanne bestellen, um
Veränderungen der Waldfläche festzustellen und zu interpretieren
(z.B. Holzschlag, Pflanzungen, usw.).
b) Vergleich der topographischen Karten
Als wir alle 1:25'000 Karten seit dem Jahr 1955 miteinander verglichen, stellten wir praktisch keine Waldflächenveränderungen fest. Ist das möglich? Oder liegt es daran, dass nicht bei jeder neuen Kartenausgabe neue Luftbilder herangezogen bzw. neue Luftbilder nicht genau ausgewertet wurden? Diese Fragen könnte man mit Hilfe der Luftbilder beantworten. Wir vermuten, dass die Karten ziemlich genau den Tatsachen entsprechen. D.h. die Waldfläche hat sich seit 1955 nicht verändert. Es ist unseres Erachtens zu diesem Zeitpunkt nicht nötig, weitere Nachforschungen anzustellen oder die Luftbilder zu bestellen.
a) Unsere Fragestellung:
Antworten dazu erhielten wir bei GeoDataWeibel, einem
Ingenieurbüro, das beauftragt wurde, eine Bestandeskarte
des Sihlwaldes zu erstellen (Adresse im Kapitel 4.4).
b) Angaben zur Bestandeskarte:
Diese Bestandeskarte ist im Massstab 1:5'000 anhand einer Orthophoto (7. März 1993) und zweimaliger Verifikation im Gelände erstellt worden. Planauswertung und Erstellung der Bestandestabellen wurden mit einem geographischen Informationssystem (ArcInfo) vorgenommen. Die Bestandeskarte ist in folgende Klassen unterteilt:
Diese Bestandeskarte wurde mit modernen Mitteln erarbeitet.
c) Unser Vorschlag:
Alle 5 Jahre eine neue Bestandeskarte erstellen, um zeitliche Veränderungen feststellen zu können. Dabei sollte mit dem bestehenden GIS weitergearbeitet werden.
a) Unserer Fragestellung
b) Antworten
Über den Sihlwald ist wenig vorhanden. Es gibt Infrarot-Falschfarbenbilder aus den Jahren 1984, 85 und 96, welche an der WSL in Birmensdorf zu finden sein sollten. Dort sind jedoch nur die Serien von Horgenerberg, Landforst und Üetliberg vorhanden. Für alle nicht erhältlichen Bilder verwies man uns an die KSL in Dübendorf. Dort ist man allerdings überzeugt davon, dass die Bilder in Birmensdorf sein müssen. Wo sind diese Serien? Wurde ein Bericht erstellt?
Wir haben die in Birmensdorf vorhandenen Bilder ausgeliehen und festgestellt, dass mit dem geflogenen «run» nur der östliche Teil des Sihlwaldes erfasst wurde. Anhand von Literatur (vgl. Literaturverzeichnis) haben wir uns informiert, wie man bei Infrarot-Auswertungen vorgegangen ist und welche Informationen und Nutzen man daraus gewinnen konnte.
Als Mitte der 80er Jahre das Thema Waldsterben in
der Politik zur Sprache kam, wurde dieses Programm zur Überwachung
des Waldzustands (bzw. des Gesundheitszustands) initiiert. Ziel
war es, den Zustand des Schweizer Waldes kontinuierlich (jedes
Jahr) zu erfassen, um eine Aussage über die Veränderungen
machen zu können. Dieses Ziel wurde jedoch nicht so erreicht,
wie man es sich anfangs vorgestellt hatte. Eine Gesamtbefliegung
der Schweiz (im Massstab 1:9'000) stellte sich als unrealistisch
heraus. Da nicht alle Kantone bereit waren, bei diesem Programm
mitzuarbeiten, wurden z.B. in den Jahren 1985 und 1986 Stichprobeninventare
gemacht. Dazu wurden von der ganzen Schweiz repräsentative
Stichprobenflächen von 500 m2 auf dem Netz des Landesforstinventars
untersucht (Dauerbeobachtungsflächen). Eine systematische
Befliegung der ganzen Schweiz wurde jedoch nicht durchgeführt.
Abbildung 4.6.1 (Anhang) zeigt die Linien («runs»),
die im Rahmen des Sanasilva-Programms geflogen worden sind.
Das Sanasilva-Programm bestand bzw. besteht aus mehreren Teilprogrammen. Eines diente der Unterstützung der Kantone bei der Interpretation von Falschfarbeninfrarot-Luftbildern. Heute könnten die Kantone theoretisch selber weitere Befliegungen ihrer Wälder vornehmen. Ein weiteres Teilprogramm von Sanasilva ist das Walderhebungsprogramm, das auch heute noch weitergeführt wird.
Das wichtigste Kriterium zur Beurteilung des Gesundheitszustands von Bäumen ist der Belaubungs- bzw. Benadelungszustand. Für das Sanasilva-Programm war daher das Infrarot-Luftbild als wichtigstes Hilfsmittel vorgesehen. Neben dem Benadelungs- und Belaubungszustand haben die Spezialisten aber auch noch weitere Kriterien erfasst (z.B. Kenngrössen für die Beschreibung des Bestandesaufbaus, der Wuchsbedingungen und Schadenbilder, welche auf spezifisch erkennbare Ursachen wie tierische Schädlinge, Schneedruck, Blitzschlag etc. zurückzuführen sind.)
Wie schon erwähnt, war die Interpretation von
Luftbildern ein wichtiges Instrument des Sanasilva-Programms.
Mit Luftbildern ist es möglich, einen Einblick in die oberen
Kronenpartien zu erhalten, welche für die Beurteilung des
Gesundheitszustands eines Baums besonders wichtig sind. Im Gegensatz
zur Methode, die von der Landestopographie bei ihren routinemässigen
Befliegungen angewendet wird (Interpretation von Schwarz-Weiss-Luftbildern),
wurden Falschfarbeninfrarot-Luftbilder verwendet, d.h. es wurde
ein Film, der auch im nahinfraroten Bereich des Spektrums (bis
0.9 µm) empfindlich ist, verwendet. Diese Bilder sind
aus den folgenden zwei Gründen besonders gut geeignet zur
Untersuchung des Waldes und seines Gesundheitszustands:
In der Regel sind zwei Arbeitsmassstäbe üblich:
1:3'000 für eine detaillierte Beurteilung der einzelnen Bäume
1:9'000 für flächenhafte Erfassung
Die Einzelbaumkartierungen dienen zur lokalen Untersuchung
der Entwicklung von Waldschäden. Damit können Veränderungen
von ganz bestimmten Bäumen über mehrere Jahre hinweg
beurteilt werden. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei allerdings,
dass die einzelnen Bäume jeweils wieder erkannt werden können,
was gar nicht so einfach ist. Die Bilder in diesem grossen Massstab
können auch dazu verwendet werden, um auf einigen eng abgegrenzten
Beobachtungsflächen die Zusammenhänge zwischen dem Schadenverlauf
und den verschiedenen Variablen wie Boden, Schadstoffeintrag und
Luftzusammensetzung darzustellen.
Bei den Luftbildern im Massstab 1:9'000 ist es das Ziel, eine grössere Fläche aufzunehmen und somit einen Überblick über den Zustand des Waldes in einem grösseren Gebiet zu erhalten. Diese Bilder geben Auskunft über den Anteil der geschädigten Waldfläche, eine Aussage zu der genauen Anzahl den geschädigten Bäume ist hier nicht mehr möglich. Aufgrund dieser Bilder wurden Schadenkarten erstellt, welche dem Forstdienst zur Planung von waldbaulichen Massnahmen dienen, aber auch für Gemeinden verwendet werden können, um sie über den Zustand ihrer Wälder zu informieren.
Teilschritte:
a) Vorarbeiten:
Erstellen eines Interpretationsschlüssels. Dieser
Schlüssel sollte für die wichtigsten Baumarten existieren.
Dabei wird ein Vergleich von Einzelbäumen in Luftbild und
Feld vorgenommen. Es wird hier die wichtigste Kenngrösse
zur Beurteilung des Gesundheitszustandes des Waldes verwendet:
Der Belaubungs-/Benadelungszustand der Bäume. Auf die lokalen
Unterschiede von Klima und Exposition muss Rücksicht genommen
werden. Schliesslich definiert man die verschiedenen Schadenklassen.
Wie man diese abgrenzen will, ist Ermessenssache. Hier stellen
wir zwei mögliche Einteilungen vor:
1) gesund, verfärbte Blätter; leichter Blatt- oder Nadelverlust; starker Blatt- oder Nadelverlust; abgestorben.
2) Einteilung des Blatt-/Nadelverlustes in 5%-Schritte:
ohne Schaden (0-10% Blatt-/Nadelverlust); schwach geschädigt
(15-25%); mittelstark geschädigt (30- 60%); stark geschädigt
oder abgestorben (mehr 65%)
b) Ausscheiden von Bestandeseinheiten: Die Waldfläche
wird in einzelne homogene Flächen unterteilt. Dazu gibt es
verschiedene Abgrenzungskriterien (Alter, Mischverhältnis
Laub-/Nadelwald).
c) Photogrammetrische Auswertung: Es wird eine Stereokartierung
vorgenommen, und die Waldbestandesgrenzen werden in einen Übersichtsplan
(1:10'000) übertragen.
d) Bestandesweise Schadenbeurteilung: Der Interpretationsschlüssel
wird auf die einzelnen Bestände angewendet. Die Merkmale
Mischungsgrad und Schaden (getrennt nach Laub- und Nadelwald)
werden im Schadenerfassungsprotokoll festgehalten.
e) Verifizierung im Wald: Bei jeder Luftbild-Interpretation
können zweifelhafte Fälle vorkommen, die nur durch die
Geländebegehung erkannt werden können. Man sollte keine
Interpretation vornehmen, ohne eine Kontrolle im Wald vorgenommen
zu haben.
f) Bereinigung und Ausarbeiten der definitiven Karten.
g) Datenauswertung und -analyse, Vergleich mit anderen Waldbeständen (gibt es Unterschiede zwischen Laub- und Nadelbäumen?), mit anderen Gegenden (z.B. alpine Gebiete versus Mittelland) und zeitliche Vergleiche.
Darstellung in Kartenform
Die Ergebnisse der Auswertung wurden in Schadenkarten dargestellt. Diese Karten zeigen für jeden Bestand den prozentualen Flächenanteil der geschädigten Bäume, ohne aber die Intensität der Schäden aufzuzeigen. Diese Darstellungsform eignet sich lediglich, wenn nur ein geringes Ausmass an Schäden vorliegt.
Will man die Schwere der Schäden festhalten, fertigt man eine Schadenintensitätskarte an. Dazu wird der durchschnittliche Schaden eines Bestandes berechnet. D.h. die einzelnen Schadenstufen werden unterschiedlich gewichtet. Ein Möglichkeit ist folgendes Vorgehen:
Der prozentuale Anteil der einzelnen Kategorien am
ganzen Bestand wird mit 0 - 4 multipliziert: 0 = gesunde Bäume,
1 = verfärbte Bäume, 2 = leichter Blatt-/Nadelverlust,
3 = starker Blatt-/Nadelverlust, 4 = abgestorbene
Bäume. Die Summe dieser fünf Produkte wird durch 100%
dividiert, um den durchschnittlichen Schädigungsgrad pro
Flächeneinheit zu erhalten. Dieser Schädigungsgrad variiert
dann zwischen 0 (alle Bäume sind gesund) und 4.0 (alle Bäume
sind schwerst geschädigt oder schon abgestorben). Mit der
Schadenintensitätskarte können hingegen keine Aussagen
über den Prozentanteil «gesund» und «krank»
gemacht werden. Ein Bestand mit einem hohen Anteil von schwach
geschädigten Bäumen kann den gleichen Wert haben wie
ein Bestand mit einem kleinen Anteil an stark geschädigten
Bäumen.
Tabellen und Graphiken
Die Ergebnisse der Auswertung können natürlich auch in Tabellenform und Graphiken dargestellt werden. Dies ist vor allem beim Vergleich von mehreren Jahren von Bedeutung. Die erhaltenen Daten sollen nicht nur aufgeschrieben, sondern auch statistisch ausgewertet werden können. Hier ist auch der Vergleich mit anderen Daten (beispielsweise Schadstoffimmissionen, Verkehrsaufkommen in der Nähe, waldbauliche Massnahmen) von Interesse.
In der Regel werden die Befliegungen für Infrarot-Luftbilder in den Monaten Juli ñ August durchgeführt. Wichtig ist hier, auf die Phänologie zu achten. Es kommt natürlich sehr darauf an, ob man in alpinen Gebieten oder im Mittelland fliegt. Die Vegetation sollte schon voll entwickelt, die Herbstfärbung darf aber noch nicht eingetreten sein. Besonders in den Alpen muss berücksichtigt werden, dass im Juli noch eine temporäre Schneedecke vorhanden sein kann.
Das Wetter muss sehr günstig sein, wenn man wirklich gute Bilder erhalten will. Die Fernsicht muss mindestens 15 km betragen, es darf weder Wolken noch Wolkenschatten und praktisch keinen Dunst haben. Diese Bedingungen schränken die möglichen Flugtage stark ein.
Damit eine sinnvolle Interpretation möglich ist, darf der Einfallswinkel der Sonne nicht weniger als 40° betragen. Die Befliegung muss zwischen 2 Std. vor und 2 Std. nach Sonnenhöchststand erfolgen.
Die Angaben für die Kosten variieren je nach
Quelle. Ausserdem muss noch beachtet werden, dass die Angaben
aus den 80er Jahren stammen (die Teuerung ist einzurechnen).
Einige konkrete Zahlen:
Die meiste Literatur, die wir zur Beschreibung des Sanasilva-Programms verwendet haben, stammt aus den Jahren 1985 und 1986, ist also nicht mehr ganz aktuell. Das neueste, was wir finden konnten, stammt von 1989. Damit wir aber dennoch aktuelle Informationen mit berücksichtigen können, haben wir uns noch mit einem Experten auf diesem Gebiet, Herrn Bernhard Oester von der WSL, unterhalten. Seine Auskünfte waren sehr interessant und sollen im Folgenden verkürzt wiedergegeben werden.
Zunächst bestätigte B. Oester unsere Meinung,
indem er ebenfalls sagte, dass er eine Befliegung des Sihlwaldes
für sinnvoll und notwendig erachtet. Da eine Inventarisierung
des Sihlwaldes nicht jährlich möglich sei, sollten unbedingt
Bilder zu Dokumentationszwecken gemacht werden, um die Veränderungen
zum jetzigen Zeitpunkt, wo der Sihlwald eine Naturlandschaft wird,
irgendwo festzuhalten. Das Luftbild stellt mit Abstand das billigste
Archivierungsmittel dar. Bei jährlichen Befliegungen des
Sihlwaldes müssten die grundlegendsten Sachen ausgewertet
werden. Eine aufwendigere Auswertung (evt. auch mit ganz neuen
Methoden, die erst in den kommenden Jahren entwickelt werden)
könne auch später noch in Betracht gezogen werden; allerdings
nur, wenn die Bilder vorhanden sind.
Wichtig sei aber, dass vor einer systematischen Befliegung
die Zielsetzung über Jahre hinaus bekannt sei, denn von dieser
hingen u.a. der Massstab und der zu verwendende Film ab. Eine
Möglichkeit sei z.B. einen Übersichtsflug im Massstab
1: 20'000 zu machen und daneben auf ein paar ausgesuchten Testflächen
eine Einzelbaumkartierung im Massstab 1:3'000, kombiniert mit
terrestrischen Messungen, vorzunehmen. Für diese Dauerbeobachtungsflächen
sei nur eine Linie über dem Sihlwald zu fliegen (d.h. geringere
Kosten).
Die Frage des Massstabs müsse unbedingt geklärt
sein. Eine Befliegung im falschen Massstab sei sehr teuer. Dabei
komme es sehr darauf an, wieviel Klassen man unterscheiden wolle.
Je mehr Klassen (d.h. je differenzierter die Untersuchung) gewünscht
würden, desto grösser müsse der Massstab sein.
Für eine gute photogrammetrische Auswertung sei allerdings
ein eher ein kleinerer Massstab vorteilhaft.
Es müssten auch die Merkmale, die man untersuchen
wolle vorher festgelegt sein, weil je nachdem ein Normalfarbenbild
geeigneter als ein Infrarot-Luftbild sei.
Das Infrarot-Luftbild eignet sich zur Unterscheidung zwischen Nadel- und Laubholz und zur Untersuchung, ob eine Kronenverlichtung stattgefunden habe. Will man dagegen die vertikale Struktur untersuchen und einen tiefen Einblick in die Räume zwischen den Bäumen haben, ist ein Normalfarbfilm besser. Letzterer habe weniger harte Konturen.
Zur Festlegung der Aufnahmezeit komme es ebenfalls
sehr auf die Fragestellung an: Richte man das Hauptaugenmerk auf
den Waldzustand, d.h. die Vegetation, solle die Befliegung während
den Monaten Juli-August stattfinden. Interessiere man sich jedoch
für den Boden, sei die beste Aufnahmezeit im Winter, wenn
die Bäume kein Laub mehr trügen, aber auch kein Schnee
liege (November, evt. Dezember, März). Für die Untersuchung
der Herbstfärbung der Bäume fliege man im Oktober.
Erst wenn alle diese Fragestellungen und Zielsetzungen klar seien, könne man eine Aussage über die bestmögliche Verwendung von (Infrarot-)Luftbildern machen.
Aufgrund der Informationen aus der Literatur, sind wir zu folgenden Schlüssen gekommen:
Falls das Stadtforstamt Zürich an einer Überwachung des Gesundheitszustands des Sihlwaldes interessiert ist, wäre es sicherlich sinnvoll, weitere Befliegungen vorzunehmen. Gerade die Tatsache, dass die Entwicklung des Waldzustands nicht einheitlich ist (weder temporal noch räumlich), zeigt, dass man nicht aufgrund allgemeiner Daten der Schweiz auf den Zustand des Sihlwaldes schliessen kann.
Auch wenn heute in der Politik Waldsterben kein Thema
mehr ist, bedeutet das nicht, dass dieses Problem nicht mehr besteht.
Die Auswirkungen der verschiedenen Schadstoffe auf die Natur,
speziell auf den Wald sind heute noch nicht vollständig geklärt.
Eine kontinuierliche Überwachung des Waldes könnte darüber
Auskunft geben. Denn auch wenn der Sihlwald eine Naturlandschaft
werden soll, werden die Schadstoffe von Verkehr und Industrie
aus der Agglomeration Zürich den Wald weiterhin beeinflussen.
Wir sehen allerdings, dass die hohen Kosten, die solche Befliegungen und die anschliessende Interpretation und Auswertung mit sich bringen, ein Problem sind. Je nachdem, welchen Hektarpreis man annimmt, belaufen sich die Kosten einer Befliegung für den Sihlwald auf Fr. 30'000-40'000 B. Oester spricht allerdings von Fr. 6'000-7'000 für zwei Fluglinien (ohne Auswertung). Diese Befliegungen müssten unseres Erachtens relativ häufig durchgeführt werden, denn gemäss dem Sanasilva-Bericht von 1986 können die Veränderungen nur schon innerhalb eines Jahres sehr gross sein. Optimal wäre eine jährliche Befliegung. Wir können nicht abschätzen, wie gross die Chance ist, das Geld dafür aufzubringen. Wir denken jedoch, dass es auf alle Fälle versucht werden sollte. Der Sihlwald ist nicht ein «gewöhnlicher» Wald. Als Naturlandschaft ist er etwas Einmaliges in der Schweiz. Gerade jetzt, wo der Wald (zumindest teilweise) sich selbst überlassen wird, ist der ideale Zeitpunkt mit der Dokumentation der Veränderungen zu beginnen. Diesen Zeitpunkt darf man nicht verpassen.
Wir denken, dass neben dem Gesundheitszustand des Waldes vor allem die Walddynamik von grosser Bedeutung ist. Es stellt sich deshalb die Frage, inwieweit Luftbilder und insbesondere Falschfarbeninfrarotbilder zur Erfassung dieser Daten geeignet sind. Um das genauer in Erfahrung zu bringen, haben wir mit B. Oester Kontakt aufgenommen (s.o.).
Um einen konkreten Vorschlag für die Befliegung
zu machen, muss die Fragestellung genau bekannt sein. Diese wird
erst im September von der wissenschaftlichen Kommission festgelegt.
Uns bleibt die Möglichkeit, nochmals auf die zentralen Punkte
hinzuweisen und die verschiedenen Optionen aufzuzeigen:
a) Zentrale Punkte (müssen durch die Fragestellung genau geklärt werden):
b) Unser Vorschlag:
Diese Flächen sollten bezüglich geographischer Lage und Höhenlage im Sihlwald verteilt liegen und von speziellem Interesse sein. Z.B. ein Gebiet, das jetzt sich selber überlassen wird; ein Gebiet, in dem noch über Jahre menschliche Eingriffe stattfinden werden; ein Gebiet, das in den nächsten 10 Jahren sich selbst überlassen wird. Im Anhang haben wir eine mögliche Anordnung dieser Flächen in einer Landeskarte eingezeichnet (siehe Kap. 4.6.2 im Anhang).
Für die Berechnung eines Flugplans ziehen wir
die beiden Bildserien, die wir aus der WSL Birmensdorf ausgeliehen
haben (Horgenerberg und Landforst), bei:
Für die Berechnung unserer Flugpläne gehen wir von folgenden Annahmen aus:
a) Übersichtsflug
Damit eine Stereokartierung möglich ist, müssen
die Aufnahmen eine hohe Überdeckung aufweisen. Die zusätzlichen
Aufnahmen, die wegen einer so hohen Überdeckung (normalerweise
beträgt die Überdeckung 60-70%) gemacht werden müssen,
verteuern die ganze Befliegung nicht wesentlich.
b) Einzelbaumkartierung auf Dauerbeobachtungsflächen
Auf einem Bild wird eine Fläche von 690 x 690 m
abgebildet.
Gemäss dem Zonenplan vom Sihlwald gibt es drei besonders interessante Waldzonen, die beobachtet werden sollten:
Für jede dieser Zonen sollten 2-3 besonders
interessante Flächen ausgeschieden werden. Zur Befliegung
kommen unseres Erachtens zwei Möglichkeiten in Frage. Entweder
wählt man Flächen, die alle auf der gleichen Höhe
liegen und muss somit nur eine Linie fliegen oder es werden zwei
Fluglinien auf zwei verschiedenen Höhen geflogen.
Hier haben wir die Fluglinien nicht aufgezeichnet,
da für die Ausscheidung der Beobachtungsflächen Spezialisten
benötigt werden.
Angaben zu beiden Flugplänen:
Als Fixpunkte kann sich der Pilot an Strassenkreuzungen orientieren.
Bilder von Landsat-TM
Es handelt sich um die Bilder, die im NPOC (National Point of Contact) archiviert sind.
(Nach dem «Landsat Reference Grid for Switzerland»
ist der Sihlwald auf den Bildern mit den Track-Frame-Nummern 195-27
und 194-27 abgebildet)
| Track | Frame | Datum | Bildnummer | Archiv |
| 194 | 27 | 02. 09. 1984 | #176 | IKT |
| 194 | 27 | 01. 06. 1985 | #190 | IKT |
| 194 | 27 | 03. 07. 1985 | #191 | IKT |
| 194 | 27 Q4 | 16. 03. 1986 | #220 | IKT, 4. Quadrant |
| 194 | 27 | 03. 05. 1986 | #278 | IKT |
| 194 | 27 | 09. 06. 1988 | #363/#370 | IKT |
| 194 | 27/28 F | 24. 03. 1989 | #272 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 09. 04. 1989 | #255 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 15. 08. 1989 | #273 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27 | 07. 02. 1990 | #412 | IKT/L+T |
| 194 | 27 | 30. 05. 1990 | #369 | IKT |
| 194 | 27/28 F | 02. 08. 1990 | #292 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 07. 08. 1992 | #401 | IKT/L+T, Fl. Sc. 30% |
| 194 | 27/28 F | 15. 02. 1993 | #388 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 22. 05. 1993 | #389 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 25. 05. 1994 | #387 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 12. 07. 1994 | #392 | IKT, Floating Scene |
| 194 | 27/28 F | 28. 07. 1994 | #393 | IKT, Floating Scene |
| Track | Frame | Datum | Bildnummer | Archiv |
| 195 | 27 | 07. 07. 1984 | #167 | IKT |
| 195 | 27 | 26. 07. 1985 | #177 | IKT |
| 195 | 27 | 12. 09. 1985 | #192 | IKT |
| 195 | 27 | 18. 05. 1989 | #312 | IKT |
| 195 | 27/28 F | 07. 09. 1989 | #282 | IKT, Floating Scene |
| 195 | 27/28 F | 09. 08. 1990 | #404 | IKT/L+T Fl. Sc. 30% |
| 195 | 27 | 11. 07. 1991 | #310 | IKT |
| 195 | 27 FQ | 30. 04. 1994 | #423 | L+T, Floating Quarter |
| 195 | 27 FQ | 17. 06. 1994 | #424 | L+T, Floating Quarter |
| 195 | 27 FQ | 03. 07. 1994 | #425 | L+T, Floating Quarter |
| 195 | 27/28 F | 03. 07. 1994 | #426 | IKT/L+T Fl. Sc. 50% |
| 195 | 27 | 04. 08. 1994 | #414 | IKT |
| 195 | 27 FQ | 04. 08. 1994 | as #414 | L+T, Floating Quarter |
| 195 | 27 | 03. 05. 1995 | #419 | IKT |
| 195 | 27/28 FQ | 03. 05. 1995 | #429 | L+T, Floating Quarter |
| 195 | 27 | 20. 06. 1995 | #420 | IKT |
| 195 | 27/28 FQ | 20. 06. 1995 | #430 | L+T/IKT Floating Quart. |
| 195 | 27/28 FQ | 22. 07. 1995 | #451 | L+T/IKT Floating Quart. |
| 195 | 27/28 FQ | 24. 09. 1995 | #453 | L+T/IKT Floating Quart. |
SPOT-Bilder
Hier gibt es deutlich weniger Bilder im NPOC-Archiv, da von SPOT
auch weniger Aufnahmen gemacht werden (nur auf Bestellung). Ausserdem
gibt es bis dato nur ganz wenige Quicklooks auf dem Internet.
Daher ist es relativ schwierig abzuschätzen, auf welchen
Bildern der Sihlwald abgebildet ist.
Vermutlich sind es Bilder mit K = 54 und 55 und J = 255 und 254. Dank dem schwenkbaren Scanner kann SPOT auch Schrägaufnahmen machen. Es ist uns daher ohnehin nicht klar, wie genau das «SPOT Reference Grid for Switzerland» auf dem Internet ist.
Allerdings gibt es auf K 53/J 254 ein Bild, wo die Nordostschweiz mit Zürichsee bis zum Untersee des Bodensees abgebildet ist.
Angaben dazu:
| K | J | Datum | NPOC-NR. | Bemerkungen |
| 53 | 254 | 02. 01. 1993 | #442 | L+T/IKT, Pan |
Weitere Bilder:
| K | J | Datum | NPOC-NR. | Bemerkungen |
| 54 | 255 | 30. 06. 1991 | #302 | Panchromatisch |
| 54 | 255 | 30. 06. 1991 | #301 | XS |
| 55 | 254 | 30. 09. 1986 | #205 | Panchromatisch |
| 55 | 254 | 30. 09. 1986 | #207 | XS |
| 55 | 255 | 30. 09. 1986 | #206 | Panchromatisch |
| 55 | 255 | 30. 09. 1986 | #208 | XS |
| 55 | 255 | 18. 04. 1988 | #226 | XS |
| 55 | 255 | 09. 06. 1988 | #233 | XS |
| 55 | 255 | 13. 06. 1989 | #256 | XS |
| 55 | 255 | 23. 04. 1989 | #251 | XS |
| 55 | 255 | 15. 07. 1989 | #260 | XS |
| 55 | 255 | 30. 08. 1989 | #267 | XS |
| 55 | 255 | 11. 06. 1990 | #283 | XS |
| 55 | 255 | 23. 08. 1990 | #288 | XS |
| 55 | 255 | 12. 04. 1992 | #315 | XS |
| 55 | 255 | 25. 07. 1992 | #326 | XS |
| 55 | 255 | 13. 08. 1992 | #330 | XS |
| 55 | 255 | 20. 03. 1993 | #336 | XS |
| 55 | 255 | 30. 03. 1993 | #341 | XS |
| 55 | 255 | 21. 04. 1993 | #347 | XS |
| 55 | 255 | 01. 06. 1993 | #350 | XS |
| 55 | 255 | 16. 06. 1993 | #353 | XS |
| 55 | 255 | 12. 08. 1993 | #360 | XS |
| 55 | 255 | 25. 03. 1994 | #382 | XS |
| 55 | 255 | 07. 04. 1994 | #383 | XS |
| 55 | 255 | 29. 04. 1994 | #384 | XS |
| 55 | 255 | 15. 06. 1994 | #390 | XS |
Serien an der Landestopographie (L+T)
In folgenden Jahren wurde der Sihlwald beflogen:
1931, 1943, 1953, 1962, 1970, 1976, 1982, 1987, 1988, 1994.
Diese Bilder können ebenfalls bestellt werden. Die Laborkopie einer Aufnahme 1:1 kostet Fr. 20, Ausschnittsvergrösserungen sind teurer (maximaler Vergrösserungsfaktor ist je nach Jahrgang 10 bis 20-fach). Zusätzlich sind günstigere Laserkopien (5 Fr./Stk.) an Stelle der Laborkopien erhältlich. Stereobilder gibt es seit 1960.
Serien im Geographischen Institut der Universität Zürich (GIUZ)
Noch nicht sortierte Bilder (in PTT-Schachteln aufbewahrt):
Bilder vom Swissair Vermessungsdienst
Der Vermessungsdienst der Swissair hat 1995 die ganze Schweiz beflogen, d.h. auch Bilder vom Sihlwald müssten dort erhältlich sein. Diese Bilder können beim Vermessungsdienst der Swissair ausgeliehen werden. Bezugsadresse:
Swissair Vermessungsdienst
Dorfstrasse 53
8105 Regensdorf
01/871 22 22
WSL Birmensdorf: Serie Horgenerberg
Serie Landforst
Serie Üetliberg
a) Der Sihlwald ist auf den Kartenblättern Albis, 1111 (im Massstab 1:25'000) abgebildet.
Seit 1955 werden die Karten der Landestopographie regelmässig mit Hilfe von Befliegungen erstellt. Es existieren Karten der Jahrgänge:
1955, 1962, 1966, 1970, 1976, 1982, 1988, 1994.
Daneben gibt es auch noch ältere Karten:
Siegfried-Karte: 1882 Thalwil 1.25'000, Blatt 175
Siegfried-Karte: 1887 Horgen 1:25'000, Blatt 177
b) Bestandeskarte von 1993
Beauftragtes Büro: GeoDataWeibel
Umweltplaner und Ingenieure
Glärnischstrasse 19
Postfach
CH-8810 Horgen
Tel. 01 725 74 44
Fax 01 725 74 43
Landesforstinventar (LFI)
a) 1983-85
Das Landesforstinventar von 1983-85 ist eine terrestrische Erhebung im 1 km-Raster. D.h. an jedem Kilometerschnittpunkt der Landeskarte der Schweiz, wo ein Waldstück existiert, wurden diverse Parameter an den Bäumen gemessen.
Davon liegen zehn Datenerhebungspunkte im Sihlwald: 683/235, 683/236,
684/234, 684/235, 684/236, 685/233, 685/234, 685/235, 686/232,
686/233.
b) 1993-95
Hier wurden die Daten des Schweizer Waldes im 2 km-Raster - also nur noch an jedem 2. Kilometerschnittpunkt der Landeskarte ñ erhoben.
Davon liegen drei Datenerhebungspunkte im Sihlwald: 684/234, 684/236,
686/232.
c) 500 m-Raster
Mit Hilfe von Schwarz-Weiss-Luftbildern (also keine rein terrestrische Erhebung) wurden als Stichprobenverfahren für die ganze Schweiz Daten in einem 500 m-Raster erhoben.
Archiv und Kosten: Die Daten dazu sind an der WSL in Birmensdorf vorhanden (zuständige Person ist zur Zeit Herr Brassel) und werden für den Forstdienst und in der Regel auch für die Forschung kostenlos zur Verfügung gestellt.
Verdichtete Erhebungen durch die Kantone
Seit neuestem gibt es Kantone, die von sich aus Erhebungen vornehmen, welche das LFI verdichten sollen. Bis jetzt wird dies aber erst in den Kantonen Graubünden, Appenzell und Bern gemacht. Der Kanton Zürich hat zwar eine Erhebung, die er selbst verwaltet, aber diese wird auch im 1 km-Raster gemacht. Es handelt sich somit um die gleichen Stichproben-Punkte. Auch in bezug auf die Parameter unterscheidet sich diese Erhebung kaum vom LFI.
Sanasilva-Erhebungen
Diese Erhebungen werden im 16 km-Raster vorgenommen. D.h. es handelt sich um einen viel gröberen Raster und ist für irgendwelche Aussagen über eine so kleine Waldfläche wie die des Sihlwalds unbrauchbar. Der Unterschied zum LFI besteht ausserdem in etwas anders gewählten Parametern und darin, dass grössere Probeflächen ausgeschieden werden (also mehr Bäume untersucht werden).
Langjährige ertragskundliche Dauerbeobachtungsflächen
In der ganzen Schweiz gibt es seit Beginn dieses Jahrhunderts
Waldflächen, die in bezug auf den Ertrag untersucht wurden/werden.
Besonders interessierte man sich für Waldflächen mit
Buchen oder Lärchen. Im Sihlwald wurden ursprünglich
24 Waldflächen regelmässig untersucht. Heute werden
noch 3 Flächen aufgenommen:
| X-Koordinate | Y-Koordinate | Höhe (m.ü.M.) | erste/letzte
Aufnahme | Fläche (ha) |
| 684.820 | 233.970 | 630 | 1907/1989 | 0.2001 |
| 684.760 | 233.840 | 650 | 1907/1989 | 0.2502 |
| 684.680 | 233.940 | 650 | 1907/1989 | 0.5000 |
Weitere Flächen sind vor allem zu Beginn dieses Jahrhunderts untersucht worden. Die ersten Aufnahmen dieser Flächen wurden in den Jahren 1890 bis 1917 gemacht, die letzten zwischen 1899 und 1931. Die Daten dazu sind an der WSL in Birmensdorf erhältlich.
Baumann (Ingenieurbüro), 1986: Waldschadenkartierung.
Sanasilva 85/86 anhand von Infrarot-Luftbildern. Bericht über
die Situation im Kanton Nidwalden. Rothenburg.
Baumann & Steiner (Ingenieurbüro), 1989:
Bericht über die Waldschadenkartierung im Gebiet Emmeten.
Rothenburg.
EAFV (Eidgenössische Anstalt für das forstliche
Versuchswesen), 1986: Sanasilva- Waldschadenbericht 1986. Bern/Birmensdorf.
Oester, B., (Eidgenössische Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft), Mündliche Auskunft,
Mai 1996. Birmensdorf.
Scherrer (Ingenieurbüro), 1987: Bericht zur
Waldschadenkartierung Zürcher Oberland. Nesslau.
Scherrer H. U., Rebmann E., 1987: Waldschadenkartierung
mit Infrarot-Luftbildern. in: Phoenix International 2/1987.
Schwarzenbach, F.H. et al., 1986: Flächenhafte Waldschadenkartierung mit Infrarotbildern 1:9'000. Birmensdorf.