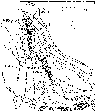
Wir erhielten von der Stiftung Naturlandschaft Sihlwald im Rahmen des Blockes "Integratives Projekt" den Auftrag, ein Konzept zur Installation von Waldklimastationen zu erstellen. Konkret geht es darum, die speziellen Klimaverhältnisse entlang der bewaldeten Talflanken an den West- und Osthängen der Sihl aufzunehmen, sowie allenfalls Veränderungen zu dokumentieren, die sich im Verlauf des Projekts im Wald, respektive sekundär im Lokalklima manifestieren. So versuchten wir bei einer Waldbegehung mögliche Standorte nach ihrer Eignung auszuwählen. Bei der Auswahl der Messparameter hatten wir weitgehend freie Hand, da von der Stiftung Naturlandschaft Sihlwald, resp. ihrem direkten Vertreter M. Christen keine Angaben bezüglich möglichen späteren Verwendungszwecken der gewonnenen Daten gemacht werden konnten. So wählten wir nach eingehendem Literaturstudium die uns am vernünftigsten erscheinenden Messparameter aus, wobei das spezielle Interesse auf dem Waldklima liegt. Im weiteren durften auch die entstehenden Kosten für Anschaffung und Unterhalt der Messstationen nicht vergessen werden, da der finanzielle Rahmen bei diesem Projekt doch eher eng gesteckt ist. In Absprache mit M. Christen einigten wir uns darauf, zwei Varianten anzuschauen: erstens eine Minimalvariante, bei der mit möglichst geringem finanziellem Aufwand eine vertretbare Lösung angestrebt werden kann und zweitens eine optimale Variante, bei der das ganze Projektgebiet möglichst repräsentativ erfasst werden kann und welche auch differenzierte Aussagen über Tal-, Hang- und Kammlagen zulässt.
Nur wenn die Niederschlags-, Temperatur- und Windverhältnisse im Untersuchungs gebiet im voraus einigermassen bekannt und spezielle lokale Gegebenheiten bestimmt sind, kann eine sinnvolle Abklärung der möglichen Messparameter und -standorte gemacht werden. Bevor wir auf die eigentliche Fragestellung genauer eingehen, möchten wir somit das Klima im Sihlwald genauer erläutern.
Da der Sihlwald in klimatologischer Hinsicht ein relativ kleines Untersuchungsgebiet darstellt, erweist es sich als schwierig, irgendwelche Literatur zu finden, die sich ausführlich mit den Klimabedingungen im Albisgebiet auseinandersetzt. Die einzige uns bekannte Publikation, welche sich vertieft mit dem Sihlwaldklima befasst, stammt aus dem Jahr 1941 von LUEDI ET AL. des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich. Es ist uns bewusst, dass es sich dabei schon fast um ëantikeí Literatur handelt. Da sich aber das Lokalklima im Sihlwald in den letzten 45 Jahren wohl nicht drastisch verändert hat, sind wir der Ansicht, die von LUEDI ET AL. (1941) gemachten Erkenntnisse auf heutige Verhältnisse einigermassen übertragen zu können, ohne allzu gravierende Fehler zu begehen. Uns fehlte leider die Zeit, die Daten verschiedener Stationen im und um das Gebiet Sihlwald auszuwerten. Neuere Klimadaten vom Albisgebiet wären jedoch sicher aufschlussreich.
Die Diskussion des Niederschlags kann sinnvollerweise aufgeteilt werden in eine Betrachtung der Verhältnisse in Längs- und Querrichtung zum Sihltal. In Längsrichtung (ungefähr N-S) ist erstens festzustellen, dass die Niederschlagsmengen von Sihlbrugg bis Langnau tendenziell eher abnehmen. Da der Staueinfluss des südlich gelegenen Gottschalkenbergs jedoch nur in beschränktem Masse bis nach Sihlbrugg reicht, ist mit einem eher geringen Unterschied der jährlichen Niederschlagsmengen zwischen Süd- und Nordrand des Sihlwalds zu rechnen (etwa 5 cm). Ein markanter Niederschlagsabfall aufgrund des verminderten Einflusses der Albiskette als Regenschwelle entsteht in Längsrichtung erst ab Leimbach bis nach Zürich. LUEDI ET AL. (1941) vermuten zudem, dass die Gewitterzellen, welche den Voralpen entlang streifen, das Sihltal als Abzweigung benützen und häufig Leimbach noch erreichen, während Zürich verschont bleibt. Eine Korrelation des Niederschlags im Sihlwald mit demjenigen in Zürich (SMA-Station) ist demnach nicht sinnvoll.
In Querrichtung sind die Niederschlagsunterschiede stärker ausgeprägt als in Längsrichtung. Im Sihlwald (Ostflanke) werden feuchte Luftmassen zum Aufstieg gezwungen, was zu einer Abkühlung und nachfolgendem Niederschlag führt. Auf der Ostseite des Albis werden folglich höhere Niederschlagssummen registriert als auf der Westseite .
Ein lokales Maximum kann zudem beim Albishorn festgestellt
werden (vgl. Abb.1).
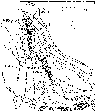
Abb. 1: Niederschlagsverteilung im Albisgebiet. Die Linien verbinden Orte mit gleichen Jahressummen ( in cm ). [LUEDI ET AL. 1941, S.7].
LUEDI ET AL. (1941) beziehen sich bei der Betrachtung
der Temperaturen nur auf die Extremwerte und verzichten auf die
Erwähnung der Durchschnittstemperaturen. Sie weisen darauf
hin, dass ihre Maxima- und Minima-Temperaturen einige Aehnlichkeit
mit den meteorologischen Mittelwerten aufweisen, im Mittel jedoch
etwas höher liegen.
Speziell für das Sihltal ist es sicher die ausgeprägte Muldenlage zwischen Sihlwald und Sihlbrugg, die dazu führt, dass sich in der Nacht ein ausgeprägter Kaltluftsee bilden kann. Die Ansammlung der kalten Luft im Talboden kann zu einer Inversionslage zwischen dem Albishorn und dem 400 m tiefer gelegenen Sihlwald führen. In einer klaren Nacht werden in Sihlwald aufgrund des Kaltluftsees geringere Temperaturen gemessen als auf dem Albishorn, während an einem wolkenlosen Sommertag die Temperaturen in Sihlwald aufgrund der Muldenlage (Wärmestau) stark ansteigen können. Die Temperaturen auf dem Albishorn variieren demnach während des Jahres aufgrund der offenen Lage viel geringer als in Sihlwald. Eine Kennzahl, welche für die Vegetation zusätzlich von einiger Bedeutung ist, stellt die Anzahl der Frosttage (= Tage mit einem Temperaturminimum kleiner als 0°C) dar. Für die Periode 1932-36 geben LUEDI ET AL. (1941) für Sihlwald 89 und für das Albishorn 92 Frosttage pro Jahr an. Bezüglich der Frostgefährdung scheint somit kein markanter Unterschied zwischen der Talstation und der Bergstation zu bestehen.
Der Vergleich der beiden Stationen Sihlwald und Albishorn hinsichtlich der Sonnenscheindauer (vgl. Abb. 2) zeigt, dass Sihlwald in den Morgenstunden etwas mehr Bewölkung als die Bergstation aufweist. In den mittleren Tagesstunden verhalten sich die beiden Stationen im Sommer annähernd gleich, während im Spätherbst und Winter infolge der reichlichen Nebelbildung die Besonnung im Sihlwald andauernd stark hinter dem Albishorn zurückbleibt. Da sich die Talnebel oft erst gegen Mittag auflösen, weist der Stundenverlauf der Sonnenscheindauer eine asymmetrische Form auf. Auch in den mittleren Tagesstunden treten charakteristische Schwankungen in der Bewölkungsstärke auf, deren Lage sich in den einzelnen Monaten etwas verschiebt. Sie erscheinen in der Talstation Sihlwald stärker ausgeprägt als auf der Bergstation Albishorn.

Abb. 2: Verteilung der mittleren monatlichen Sonnenscheinstunden der Stationen Albishorn und Sihlwald auf die einzelnen Tagesstunden. Die Werte des Albishorns sind in dicker Linie wiedergegeben, diejenigen von Sihlwald mit feinen Linien. [LUEDI ET AL. 1941, S.29].
In der Publikation von LUEDI ET AL. (1941) werden die Windverhältnisse im Sihltal nicht explizit erwähnt. Der Wind wird lediglich zur Erklärung von Temperatur- oder Niederschlagsunterschieden erwähnt. Wir stützen uns darum bei der Beurteilung der Windbedingungen vor allem auf die Aussagen von Herrn Böhm (WSL) und von Herrn Richner (ETHZ).
Auf der Bergstation Albishorn werden in den meisten Fällen die Windverhältnisse der freien Atmosphäre gemessen, während in Sihlwald lokale Windzirkulationen zu einer ganz anderen Windrichtung und -stärke führen können. Herr Richner vermutet zudem aufgrund der steilen Ostflanke der Albiskette Hangzirkulationen, welche in bodennahen Schichten zu komplexen Windverhältnissen beitragen können. Um genauere Aussagen über Luftströmungen im Sihlwald machen zu können, müssten sicher umfangreichere Messungen durchgeführt werden, um nicht zuletzt auch den Waldeinfluss mitberücksichtigen zu können.
Die am nächsten gelegene automatische SMA-Station befindet sich in Wädenswil. Warum diese als Referenzstation ungeeignet ist wird in Kapitel 3.5.1.2 erläutert. Die Daten von Wädenswil können aber sehr wohl dazu verwendet werden, Klimaabweichungen des Sihlwaldes gegenüber anderen Regionen festzustellen. Die ANETZ-Station liefert seit 1980 Daten in 10-Minuten und zum Teil 60-Minuten-Intervallen. Die 10-Minuten-Daten sind momentan aber nicht überprüft, nur die Stundendaten wurden bereinigt. Gemessen werden folgende Parameter:
In Sihlbrugg und Langnau am Albis befinden sich Niederschlagsstationen, welche einmal pro Tag die Niederschlagsmenge messen. Sihlbrugg liefert seit 1921 vereinzelt und seit 1943 kontinuierlich Niederschlagsdaten. In Sihlwald befand sich zwischen 1880 und 1937 eine Station. Auch die Station Albishorn existiert heute nicht mehr. Alle Daten können in den Annalen der SMA nachgelesen oder bei der SMA (für wissenschaftliche Zwecke gratis) bezogen werden.
Die Datenmenge erscheint unzureichend; man darf nicht vergessen, dass die grössten regionalen Abweichungen im Sihlwald verglichen mit anderen Gebieten gerade beim Niederschlag zu erwarten sind.
Die Station Üetliberg (heute ENTE) misst nur noch Windrichtung und -stärke. Ihre Daten könnten bei der Minimalvariante (siehe Kapitel 3.5.1.2) eingesetzt werden, um Näherungswerte zu erhalten (siehe Abb. 3.9.1 im Anhang)
Wir haben die SMA auch angefragt, ob sie daran interessiert wäre, im Sihlwald eine ANETZ-Station zu errichten. Darauf bekamen wir aber einen negativen Bescheid. Das bestehende Messnetz ist für schweizerische Verhältnisse genügend dicht.
Die Hardware für das jetzige ANETZ ist jedoch ausgelastet. Aus diesem Grund ist für 1998 die Installation eines neuen Netzes geplant. Falls die Stiftung Naturlandschaft Sihlwald ernsthaft an einer SMA-Messstation interessiert ist und ein Bedarf besteht, sollte sie 1998 unbedingt wieder Kontakt mit Herrn R. Dössegger aufnehmen, der dieser Idee keineswegs abgeneigt wäre.
Im Verlauf unserer Arbeit waren wir im Gebiet des Sihlwaldes und schauten uns gewisse Standorte 1:1 im Gelände auf ihre Eignung hin an. Wir hatten die entsprechenden Plätze zuvor anhand der Landeskarte Albis 1:25'000 (Blatt 1111) und mit den von Herrn Böhm (WSL) genannten Kriterien ausgewählt.
Bevor wir nun aber zu den konkreten Standplätzen kommen, vorausgehend noch einige Worte zu einem Problem, das sich an jedem Standort stellt: Die Baugenehmigung.
Prinzipiell muss immer ein Baugesuch eingereicht werden. Da wir uns auf dem Gebiet der Gemeinde Horgen bewegen, ist dieses Gesuch an das Bauamt Horgen zu richten, von dort aus wird das Gesuch dann an die entsprechende Fachstelle weitergeleitet. Will man eine Station auf privatem Grund errichten, so muss zusätzlich zum Baugesuch noch eine schriftliche Genehmigung des Grundstückbesitzers beigelegt werden, in der er sich mit dem Errichten einer Wetterstation auf seinem Grundstück einverstanden erklärt.
Doch nun zu unseren konkreten Standortvorschlägen für die Messstationen:
a) Ein Talstandort an der Sihl im Bereich des Sihlwaldschulhauses. (Landeskoordinaten 684.85/ 235.65)
Da auf diesem Gelände wenig Probleme mit der Baugenehmigung (Zustimmung des Grundbesitzers) zu erwarten sind, schlagen wir vor, eine erste Station im Garten des Forstamtes aufzustellen. Wir haben diesen Standort ausgewählt, weil er sich einerseits ungefähr im Zentrum des Sihltales befindet, und andererseits eine genügend grosse freie Fläche besteht um den Wind, sowie weitere Parameter ungestört vom Waldeinfluss zu messen.
Wichtig beim Erfassen des Talklimas ist, dass verschiedene
topographisch bedingte Klimaeinflüsse zu berücksichtigen
sind. So wird zum Beispiel die Strahlung stark beeinflusst durch
den Schattenwurf der Talhänge: Je steiler und enger der Talquerschnitt,
um so weniger Strahlung erreicht den Talboden. Auch die Windverhältnisse
können stark von der Talform abhängen. So nimmt die
Häufigkeit der Windrichtungen, die talparallel verläuft,
relativ zum freien Gelände zu. Täler bilden also richtige
"Windkanäle". Bei klarem Himmel bilden sich in
Tälern thermische Windsysteme. Am Tag strömt die Luft
von den Höhen in das wärmere, als Heizfläche dienende
Tal, nachts fliesst die im Tal entstandene Kaltluft talabwärts.
Infolge der Bremswirkung des Reliefs liegt die Windgeschwindigkeit
am Talgrund allerdings wesentlich niedriger als in der Höhe.
Mit der Windgeschwindigkeit wird auch die Turbulenz vermindert.
Austauschprozesse in vertikaler Richtung sind im Tal also im Vergleich
zur freien Ebene erschwert. Das gilt ganz besonders, wenn sich
im Tal eine Sperrschicht (Temperaturinversion) ausgebildet hat.
Der Austausch kommt dann völlig zum Stillstand. Die wichtigste
Konsequenz aus dieser Situation besteht in der hohen Konzentration
von Luftverunreinigungen im Tal, falls Rauchquellen am Talgrund
vorhanden sind. Ausserdem reichert sich die Luft mit Wasserdampf
an (Nebel).
Die Temperatur wird gemeinsam von den Strahlungs- und Windverhältnissen gesteuert. Am besten macht man sich das am Verhalten der täglichen Temperaturextreme klar. In breiten flachen Tälern wie dem Sihltal dominiert der Einfluss der geringen Windgeschwindigkeit. Am Tag ist es relativ warm, weil die zugestrahlte Wärme nur langsam nach oben wegtransportiert wird. Nachts sinken die Temperaturen dagegen stark ab, da kein Wärmenachschub aus den höheren Luftschichten erfolgt. Es bilden sich Kaltluftseen aus. Oberhalb des Kaltluftsees liegt die warme Hangzone, in der für die Vegetation insgesamt bessere Bedingungen herrschen als im Kaltluftsee. Um all diese grundlegenden Messparameter einmal aufzunehmen, braucht es eine Station, die nicht direkt im Wald liegt, und somit verfälschte Messresultate liefert (tiefere Temperatur- und Strahlungswerte aufrund des Schattenwurfes, geringere Windgeschwindigkeiten wegen der Bäume).
b) Eine Bergstation auf dem Albishorn (Landeskoordinaten 683.6/ 233.9)
Auf dem Albishorn möchten wir wiederum eine Station errichten, mit der sich einige Parameter aufnehmen lassen, ohne den Waldeinfluss in den Messresultaten berücksichtigen zu müssen. Bei einem Gespräch mit dem Wirt des Restaurants ëAlbishorní zeigte es sich aber, dass es noch einige Probleme zu lösen gilt. Erstens steht der Wirt zur Zeit in Verhandlungen mit der Stadt, um das Gebäude zu kaufen. Da es sich um ein 40-jähriges Gebäude handelt und die Stromversorgung damals nicht für heutige Zeiten dimensioniert wurde, hat er Angst, dass das ganze Netz zusammenbrechen könnte. Ein drittes Problem stellt die Frage dar: Wer bezahlt ihm den Strom? Als wir auch noch erwähnten, dass die Messstation in einem weissen Holzkasten untergebracht wäre, war er für gar nichts mehr zu begeistern. Es dürfte daher schwer werden, eine Messstation auf dem Albishorn zu plazieren. Eventuell hätte aber eine andere Person bei einem erneuten Versuch mehr Glück als wir. Es hängt sicher auch noch davon ab, ob das Gebäude weiterhin in Stadtbesitz bleibt oder ob es in Privatbesitz übergeht.
Als Alternative würden wir eine Station auf dem Hochwachtturm (Landeskoordinaten 682.7/ 235.6) vorschlagen, wobei dort das Problem der Stromversorgung evt. mit Loggern gelöst werden müsste.
Noch einige allgemeine Worte zum Erfassen des "Bergklimas": Die Intensität der Sonnenstrahlung nimmt wegen der geringeren Trübung durch Staub und Dunst zu. Die Windgeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Höhe zu, vor allem im Kammbereich. Die Luftfeuchtigkeit nimmt bei zunehmender Höhe und sinkender Temperatur zu.
c) Eine Waldstation und eine Referenzstation: "Vorderen Riesleten" (Landeskoordinaten 684/ 236.2) und "Summerhalden" (Landeskoordinaten 683.35/ 235.85)
Zu jeder Waldstation gehört immer eine entsprechende Referenzstation auf einer freien Fläche in unmittelbarer Nähe zur Waldstation. Dabei müssen einige spezielle Punkte berücksichtigt werden. Soll eine Messstation an einem Hang zu liegen kommen (wie hier bei uns auf der Westseite der Sihl), so sollte das Messgebiet am besten auf einer "Nase" zu liegen kommen, um den Hangwindeinfluss zu minimieren, da sonst chronisch zu tiefe Temperaturen gemessen würden. (Hangeinfluss anstelle des Waldeinflusses). Die Waldstation sollte soweit im Wald liegen, sodass der Abstand zum nächsten Waldrand mindestens das Zehnfache der Höhe der Bäume im Wald beträgt, damit äussere Einflüsse vernachlässigt werden können. Zudem muss die Messstation in einem hochstämmigen Waldstück aufgestellt werden, um die effektive Lufttemperatur sowie die Luftfeuchte zu messen, die sonst sehr stark durch die krautige Unterschicht beeinflusst würde (ansonsten würde die Pflanzenoberflächentemperatur gemessen, an Stelle der Waldtemperatur). Das waldfreie Gebiet, auf dem die Referenzstation zu liegen kommt, sollte einen Mindestdurchmesser von 2-4 Baumhöhen aufweisen, um den Waldeinfluss zu minimieren.
Da das Gebiet des Sihltales sehr stark bewaldet ist, mussten wir die möglichen Stationsstandorte anhand der vorhandenen Lichtungen, die auf der Landeskarte (Nr. 1111 Albis) eingezeichnet sind, festlegen. Es blieben am Ende nur zwei mögliche Standorte an der Westseite des Sihltales übrig, die wir bei der Begehung näher untersuchten. Das Gebiet der "Vorderen Riesleten" (Landeskoordinaten 684/ 236.2) sowie das Gebiet der "Summerhalden" (Landeskoordinaten 683.35/ 235.85).
"Vordere Riesleten": Die Lichtung auf dem betreffenden Gebiet wäre optimal, sie befindet sich auf einer "Nase", und zudem ist ein Gebäude und somit Strom in der Nähe. Allerdings wird die Wiese landwirtschaftlich genutzt und wir denken, der Bauer hätte keine Freude, eine Messstation mitten auf sein Feld plaziert zu bekommen. Eine Station am Waldrand kommt aber aus den oben genannten Gründen nicht in Frage. Das Umfeld der Lichtung ist allerdings nicht sehr geeignet. Südlich der Lichtung erfolgt ein steiler Geländeabbruch, westlich und östlich der Wiesenfläche steigt der Hang in Richtung Grat an, respektive fällt zur Sihl hin ab, ohne dass die nötigen Distanzen zum Waldrand für eine Waldstation erreicht würden. Einzig nördlich der Lichtung wäre das Waldstück genügend gross und erst noch auf der selben Höhe ü.M. wie die geplante Referenzstation, allerdings haben wir es in diesem Gebiet mit einem sehr jungen Buchenwald zu tun, der aufgrund seiner z.Z. noch niederen Wuchsform zur Errichtung einer Waldklimastation ziemlich ungeeignet ist.
"Summerhalden": Gute Bedingungen zur Errichtung
einer Referenzstation sind nur am südlichen Ende der Lichtung
"Summerhalden” gewährt. Dort befindet sich die
einzige einigermassen ebene Stelle (Nase) der ganzen waldfreien
Fläche. Die erforderliche Grösse der Lichtung wird nur
sehr knapp erreicht, allerdings entstehen hier vermutlich keine
Nutzungskonflikte. Ein Problem stellt hier die Stromversorgung
dar. Sowohl für die Referenzstation als auch für die
geplante Waldstation, für die es ca. 200 m südlich der
Referenzstation einen geeigneten Standort geben würde (horizontaler,
hochstämmiger Wald in ungefähr gleicher Meereshöhe
wie die Referenzstation), gibt es kein Gebäude in der Nähe
von dem der Strom bezogen werden könnte.
Dies sind nun also unsere Vorschläge für mögliche Standorte von Klimamessstationen (siehe Abb. 3.9.2 im Anhang). Die einen sind sicher ziemlich problemlos realisierbar (Station Sihltal), während es für andere doch noch etlicher Abklärungen bedarf (Station Albishorn).
Je nach finanziellem Rahmen, der der Stiftung Naturlandschaft Sihlwald Verwirklichung während der Realisierung gesteckt sein wird, kann man sich dann für die Realisierung der einen oder anderen Variante entscheiden. Doch dies ist ein nächster Schritt, der über unseren Auftrag im Rahmen des Projekts "Erfassen des Waldklimas" hinausgeht.
Die Anzahl und Art der zu messenden Parameter ist nicht allgemeingültig festzulegen und unterliegt den subjektiven Präferenzen des Stationsbetreibers. Somit kann aus unserer Sicht lediglich ein Vorschlag gemacht werden, welche klimatischen Grössen wir zur Beschreibung des Waldklimas als sinnvoll oder gar notwendig betrachten, wobei unsere Empfehlungen grösstenteils in Zusammenarbeit mit Herrn Böhm und Herrn Dössegger entstanden sind. Mit der Festlegung der Parameter wird dann indirekt auch gerade die Grösse einer zu errichtenden Station bestimmt. Nebst den Messgrössen sollte sich der Betreiber einer Messstation auch Klarheit darüber verschaffen, mit welcher zeitlichen Auflösung und in welcher Form die Daten aufgenommen werden sollen. Nicht zu vergessen sind die Fragen der Energieversorgung, welche je nach Schwierigkeiten und Aufwand einen beträchtlichen Anteil an den Errichtungskosten ausmachen können. Für Messstationen fernab eines Anschlusses an das Elektrizitätsnetz bestehen drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder werden 1. Batterien verwendet, 2. teure Solarpanels errichtet oder 3. ein unterirdisches Kabel zum nächstgelegenen Anschluss verlegt.
In der Folge möchten wir zuerst geeignete Bestückungsvarianten der einzelnen Stationen im Sihlwald vorstellen und begründen, um dann im Kapitel 3.5.2 auf Fragen bezüglich der Messdaten eingehen.
Wie bereits im Kapitel 3.4 erwähnt, besteht
die Optimalvariante aus der folgenden Messstationenkonfiguration:
1 Talstation, 1 Bergstation, 1 Waldstation und 1 dazugehörige
Referenzstation auf einer Lichtung. Die Talstation sollte einerseits
allgemeine Grössen wie Niederschlag und Lufttemperatur in
2 m Höhe messen. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit
empfehlen wir eine Temperaturbestimmung 2 m über Boden, da
die SMA gesamtschweizerisch in derselben Höhe die Lufttemperaturen
misst. Die Ermittlung der Lufttemperaturen kann ergänzt werden
durch eine Temperaturmessung im Boden, wobei die Messtiefe je
nach Problemstellung variiert werden kann. Die Bodentemperatur
kann zum Beispiel zur Erfassung von Bodenfrost und dessen Eindringungstiefe
verwendet werden. Die Luft- und Bodentemperaturen können
ergänzt werden durch die Messung der Luft- bzw. Bodenfeuchtigkeit
in derselben Höhe respektive Tiefe. Zu den im Boden bestimmten
Grössen muss angefügt werden, dass es schwierig ist,
Bodenwerte zweier Stationen auf unterschiedlichem Untergrund miteinander
zu vergleichen, da verschiedene Bodenarten unter gleichen äusseren
Einflüssen anders reagieren. Folglich sollten die Stationen,
welche Bodenparameter aufnehmen, auf demselben Boden stehen. Ansonsten
muss beim Interpretieren den verschiedenen Bodenarten Rechnung
getragen werden. Im Talboden kann zudem die Windrichtung und -stärke
von einigem Interesse sein, welche analog zur SMA 10 m über
Grund gemessen wird. Die Windgrössen sind für das Verständnis
der Lokalzirkulation nützlich, das wiederum zum Beispiel
für ein Schadstoffausbreitungsmodell von Nutzen sein kann.
Als letzte Messgrösse könnten wir uns die Strahlung,
beziehungsweise Sonnenscheindauer vorstellen, mit deren Hilfe
unter anderem abgeschätzt werden kann, wie stark sich die
Tallage und der Hochnebel auf die Einstrahlung auswirken.
Für die Bergstation sehen wir als geeignete Parameter die Lufttemperatur und -feuchtigkeit, Windrichtung rsp. -stärke sowie die Strahlung. Die Strahlung der Bergstation kann verglichen werden mit derjenigen der Talstation, womit ein aussagekräftiger Vergleich bezüglich der Einstrahlungsverhältnisse im Tal rsp. auf der Krete gemacht werden kann (Nebel, Dunst). Die Windrichtung und -stärke auf dem Albishorn kann, in genügend exponierter Lage gemessen, als Referenzwert für die freie Atmosphäre betrachtet werden. Der Niederschlag sollte auf dem Albishorn nicht gemessen werden, weil durch kammnahe Turbulenzen und Lee-Effekte ungenaue und nichtrepräsentative Werte gemessen werden können.
Das Vorgehen, um den Einfluss des Waldes zu bestimmen, besteht in vereinfachter Form darin, dass eine Station im Wald unter Waldbedingungen misst, und eine Referenzstation in einer Lichtung Werte liefert, welche möglichst ohne Waldeinfluss bestimmt wurden. Von zusätzlichem Interesse kann zudem im Sihlwald sein, wie sich das Waldklima im Laufe der Zeit durch das ëSich-selbst-Ueberlassení verändert. Um das Waldklima einigermassen zu erfassen, sollte die Waldstation folgende Grössen aufzeichnen:
Niederschlag, Luft- und Bodentemperatur, Luft- und
Bodenfeuchtigkeit sowie die Strahlung. Die Strahlungsmessung im
Wald ist dann sinnvoll, wenn Auskunft darüber verlangt wird,
wieviel Strahlung die Bodenvegetation noch erreicht. Die Referenzstation
nimmt genau die gleichen Parameter auf, wobei zusätzlich
eine Windmessung sinnvoll sein kann, um allfällige Hangzirkulationen
erfassen zu können. Die Kenntnis von Hangwinden ist unter
anderem darum nützlich, weil der Temperaturfühler durch
den Wind zu tiefe Temperaturen misst und diese bei bekannter Windstärke
korrigiert werden können.
Im Kapitel 3.2 wurde darauf hingewiesen, dass eine Besonderheit des Sihltals in der Neigung zur Ansammlung von kalter Luft im Tal besteht. Da der Kaltluftsee die Entwicklung der Vegetation beeinflusst, kann es interessant sein, zu wissen, in welcher Höhe sich die Inversionschicht befindet. Von Herrn Böhm von der WSL wurde uns eine einfache Methode aufgezeigt, die es ermöglicht, die vertikale Ausdehung der Kaltluftschicht abzuschätzen. Von der gemessenen Temperatur der Bergstation wird mit dem trockenadiabatischen Temperaturgradienten (0.98 °C/100 m) nach unten gerechnet, während von der Temperatur im Talboden feuchtadiabatisch nach oben extrapoliert wird, was beim Schnittpunkt der beiden Geraden die ungefähre Lage der Inversionhöhe ergibt. Da sich der feuchtadiabatische Temperaturgradient je nach Temperatur, Feuchtigkeit und Druck verändert, muss zu dessen Bestimmung bei der Talstation eine zweite Temperaturmessung in z.B. 10 m Höhe erfolgen. Aus der Differenz der Temperaturen in 2 m und 10 m Höhe kann anschliessend der feuchtadiabatische Temperaturgradient ermittelt werden.
Im Rahmen der Minimalvariante haben wir uns die Bestückung der Waldstation recht bescheiden vorgestellt. Nebst dem Niederschlag, der Luft- und Bodentemperatur wird noch die Luftfeuchtigkeit gemessen. Um eine grobe Ahnung der Windrichtung und -stärke zu erlangen, könnten die Daten des SMA-Windmessers auf dem Üetliberg-Sendeturm benutzt werden. Die nächstgelegene ANETZ-Station Wädenswil kann kaum als eine Referenzstation für den Sihlwald betrachtet werden, da die Messungen in Wädenswil vom nahliegenden Zürichsee stark beeinflusst werden.
Wir haben, ob Minimal- oder Optimalvariante, alle Stationen als fest installierte Stationen vorgesehen, da die Messdauer auf jeden Fall mehrere Jahre betragen sollte. Evt. könnte mit Messungen von mobilen Stationen der Waldstandort (mit Referenzstation in Lichtung) optimiert werden. Um ganz spezielle Lokalphänomene zu erfassen, kann es durchaus sinnvoll sein, eine mobile Station zu verwenden. Der Vorteil einer solchen Station liegt darin, dass sie an verschiedenen Orten eingesetzt werden kann, während der Nachteil darin besteht, dass nur einzelne Punktmessungen ohne zeitliche Konstanz resultieren.
Die zeitliche Auflösung, mit der die Daten aufgenommen werden, kann je nach vorhandenem Budget und Verwendungszweck zwischen einem Tag und 10 Minuten variieren. Für das Messnetz im Sihlwald schlagen wir eine zeitliche Auflösung von einer Stunde vor, d.h., dass jede Stunde ein Mittelwert aufgezeichnet wird. Wenn nur ein Mittelwert pro Tag erfasst würde, könnten keine Tagesgänge ersichtlich werden. Eine 10-Minuten-Auflösung ist einerseits recht genau und aufwendig (6 mal grösserer Datenumfang) und andrerseits zum jetzigen Zeitpunkt schwer mit SMA-Daten vergleichbar, da die SMA momentan nur Werte in stündlicher Auflösung liefert, die überprüft und bereinigt sind. Die zukünftige Entwicklung tendiert jedoch zur Datenerfassung in der höheren Auflösung von 10 Minuten.
Zur Datenspeicherung empfehlen wir ein Gerät, das die Messwerte digital speichert. Heute werden keine Registrierungen auf Papier (Lochkarten) mehr verwendet, da sie schwierig zu eichen, zu digitalisieren und auszuwerten sind. Der von der SMA angewandte "online"- Betrieb der Messstationen (Daten werden direkt an eine Zentrale übermittelt) ist für das Messnetz im Sihlwald nicht nötig. Der Vorteil des "online"- Betriebs, dass eine sofortige Auswertung der Daten erfolgen kann und Störungen sofort ersichtlich sind, ist mit einem massiv erhöhten finanziellen Aufwand verbunden. Viel billiger ist die Datenspeicherung mit einem Logger, der ungefähr jeden Monat auf Störungen überprüft werden sollte, damit kein längerer Aufzeichnungsunterbruch entsteht.
Wir haben bei zwei Firmen Kostenvoranschläge für unsere Optimal- und Minimal-variante eingeholt. Es handelt sich dabei um die Markasub AG in Basel und die Meteolabor AG in Wetzikon.
Die Meteolabor ist ein Partner der SMA und kann u.a. Geräte hohen Standards (Messgenauigkeit, Eichung etc.) liefern. Das Material könnte bei Bedarf auch gemietet werden, was bei einer Messdauer von mehreren Jahren aber kaum in Frage kommt. Als weitere Variante schlägt Herr Ruppert (Meteolabor AG) vor, die Stationen durch die Firma errichten zu lassen und dieser die Daten dann abzukaufen. Dieser Vorschlag müsste sicher noch geprüft werden. Falls Geräte der Meteolabor eingesetzt würden, wäre ein Vergleich mit ANETZ-Daten problemlos zu realisieren.
Die Markasub vertreibt kostengünstigere Geräte der Marke Campbell, die jedoch ebenfalls relativ hohen Ansprüchen genügen und durchaus eingesetzt werden könnten.
Ein wesentlicher Kostenfaktor stellt die Windmessung dar. Der dazu benötigte 10 m hohe Mast kostet samt Fundament ca. Fr. 10'000. Hier könnten also noch Kosten gespart werden.
Einsparungen könnten auch dadurch erzielt werden, dass die Universität die Programmierung übernehmen würde.
Beide Offerten umfassen neben den Geräten Lieferung, Programmierung, Installation und Inbetriebnahme der Stationen. Ausgegangen wurde von Messungen in 10-Minuten-Intervallen mit Hilfe von Loggern, da ja teilweise keine Stromversorgung vorhanden ist.
Minimalvariante:
Eine Waldstation, ausgerüstet mit:
Total Kosten:
Markasub: ca. Fr. 15'000 Meteolabor: ca. Fr. 50'000
Optimalvariante:
Eine Bergstation, ausgerüstet mit:
Kosten:
Markasub: ca. Fr. 20'000 Meteolabor: ca. Fr. 62'000
Eine Waldstation, ausgerüstet mit:
Kosten:
Markasub: ca. Fr. 18'000 Meteolabor: ca. Fr. 56'000
Eine Referenzstation auf einer Lichtung, ausgerüstet mit:
Kosten:
Markasub: ca. Fr. 22'000 Meteolabor: ca. Fr. 71'000
Eine Talstation, ausgerüstet mit:
Kosten:
Markasub: ca. Fr. 22'000 Meteolabor: ca. Fr. 71'000
Total Kosten:
Markasub: ca. Fr. 82'000 Meteolabor: ca. Fr.
260'000
Die Kosten für die Betreuung der Stationen konnten wir leider nicht eruieren. Sie dürften sich aber in Grenzen halten, da es genügt, die Logger zweimal pro Monat auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Diese Arbeit könnte auch von einem der Forstwarte übernommen werden. Grösser ins Gewicht fallen dürfte der Bereich der Datenverarbeitung. Diesen Teil könnte eventuell die Stiftung Naturlandschaft der SANW übernehmen.
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten ist es uns nun doch gelungen, diese Arbeit in befriedigender Form abzuschliessen. Nicht zuletzt verdanken wir dies den Firmen Markasub und Meteolabor, die uns relativ kurzfristig eine Offerte vorgelegt haben. Für die Überlegungen und Entscheide der Froschungskommission Sihlwald dürfte der finanzielle Aspekt doch eine wichtige Rolle spielen.
Die Waldklimaerfassung ist eine teure Angelegenheit. Man darf jedoch nicht ausser Acht lassen, dass die Messstationen Daten über Jahrzehnte hinweg liefern könnten. Am billigsten käme die Datenerfassung natürlich, wenn die SMA eine Station im Sihlwald errichten würde, auch wenn diese Lösung der Minimalvariante näher käme als unserer empfohlenen Optimalvariante. Wir schlagen vor, dass die Stiftung Naturlandschaft ab 1998 daraufhin arbeitet, dass das Gebiet Sihlwald eine eigene Station erhält.
Unser Bericht enthält nur die Grundlagen für ein Konzept . Wir hoffen aber, dass er die Arbeit der Kommission erleichtern wird, wenn sie sich mit der Klimaerfassung auseinandersetzt. Der Beizug eines Meteorologen wird jedoch unumgänglich sein.
Wir möchten an dieser Stelle Herrn Dössegger von der SMA und Herrn Böhm von der WSL herzlich für ihre Beratung danken, ohne die wir mangels spezialisierter Literatur kaum ans Ziel gelangt wären.
Flemming, G., 1982: Wald Wetter Klima, Deutscher
Landwirtschaftsverlag. Berlin.
Luedi, W., Stuessi, B., 1941: Die Klimaverhältnisse
des Albisgebietes. Verlag Hans Huber. Bern.
Mitscherlich, G., 1971: Wald-Wachstum und Umwelt.
J.D. Sauerländerís Verlag. Frankfurt am Main.
Schuetz, M., 1992: Wettermesstechnik - Grundlagen,
Schaltungen, Anwendungen. Kriebel Verlag. Schondorf.
Schweizerische Meteorologische Anstalt, 1994: Meteorologische
Stationen der Schweiz 1993/94. Karte 1:1'000'000. Zürich.
Schweizerische Meteorologische Anstalt, 1980: Projekt ANETZ 1974-1980. Zürich.
Weiterführende Literatur
Mueller, G. (SMA), 1980: Die Beobachtungsnetze der
Schweizerischen Meteorologischen Anstalt. Zürich.
Nationalfondprojekt 14, Band Nr.4, Schuepbach, E.,
1991: Meteorologie und Luft chemie in Waldbeständen. Verlag
der Fachvereine. Zürich.
World Meteorological Organization, 1970: The planning
of meteorological station networks. WMO-No.265.TP.149. Genf.
World Meteorological Organization, 1983: Guide to
meteorological instruments and methods of observation. WMO-No.8.
Genf.
World Meteorological Organization, 1986: Guidelines on the selection of reference climatological stations from the existing climatological station network. Genf.
Adressverzeichnis
Firmen:
ï Markasub AG, Herr Dr. S. Reber, p.o.box, Lindenhofstrasse 34, 4002 Basel, Tel. 061/272 40 44, Fax 061/272 41 53.
ï Meteolabor AG, Herr P. Ruppert, Hofstrasse
92, 8620 Wetzikon, Tel. 01/932 18 81, Fax 01/932 32 49.
Beratung:
ï Herr R. Dössegger, Sektion Daten, Krähbühlstrasse 58, SMA, 7044 Zürich, Tel. 01/256 91 11, Fax 01/256 92 55.
ï Herr Dr. H. Böhm, WSL, 8903 Birmensdorf.
3.9.1 Meterologische
Stationen der Schweiz
 Übersichtsplan Sihlwald
Übersichtsplan Sihlwald