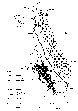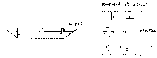
Bevor wir konkret auf das Verkehrskonzept eingehen,
möchten wir kurz die grundsätzlichen Vorstellungen charakterisieren,
auf welchen unsere Arbeit basiert.
Im ersten Teil (Kapitel 6.2) machen wir uns Gedanken über das Besucherprofil, die erwarteten Besucherzahlen und zur öV-Akzeptanz, um anschliessend den angestrebten Modalsplit definieren zu können. Der Modalsplit bildet die Basis für die nachfolgende Berechnung der allenfalls benötigten Parkplätze.
Kapitel 6.3 stellt eine Bestandesaufnahme der Infrastruktur dar, welche als Grundlage für die anschliessende Darstellung der Konfliktpunkte (Kapitel 6.4) dient. Hier werden zu den erwarteten Problemen immer auch gleich Verbesserungsvorschläge angebracht. In Kapitel 6.5 stellen wir zwei Beispiellösungen (Zoo und Sauriermuseum Aathal) dar, an welche wir uns z.T. auch anlehnten für unser Konzept.
Im Verlaufe unserer Arbeit tauchten weitere mögliche
Nutzer des Areals rund um den Bahnhof Sihlwald auf - diese kommen
im Kapitel 6.6 zu Sprache. Kapitel 6.7 ist die tabellierte und
etappierte Darstellung der Massnahmen, auf welches ein Schlusskommentar
folgt. Ganz zuletzt steht eine Auflistung der Kontaktpersonen,
welche für die weitere Arbeit an der Verkehrslösung
von Bedeutung sein wird.
Anmerkung:
Aus Kapazitätsgründen war es uns nicht möglich, das jetzige Verkehrsaufkommen im Sihlwald systematisch zu erheben. Ebenfalls verfügen wir über keinen theoretischen Hintergrund, wie ein Verkehrskonzept aufzubauen ist. Wir stützen uns deshalb primär auf bestehende Untersuchungen und Erfahrungen.
Abkürzungen
| AGW: | Amt für Gewässerschutz |
| ARP: | Amt für Raumplanung |
| MIV: | Motorisierter Individualverkehr |
| NFP: | Nationales Forschungsprogramm |
| öV: | Öffentlicher Verkehr |
| P+R: | Park and Ride |
| SZU: | Sihltal-Zürich-Üetliberg-Bahn |
| TROL: | Thalwil-Rundkurs-Oberrieden-Langnau |
| VSS: | Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute |
| ZMB: | Verein Zürcher Museumsbahn |
| ZPZ: | Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg |
Vorauszuschicken ist, dass in diesem Kapitel z.T. auf Erfahrungen vom Sauriermuseum Aathal und dem Zoo Zürich zurückgegriffen wird. Diese sind unter Kapitel 6.5, Beispiellösungen, genauer beschrieben.
Die Zielgruppen sehen nach den "Zielvorstellungen
für das Naturzentrum Sihlwald" von M. Christen und R.
Casanova folgendermassen aus:
Naturzentrum:
Familien, Bildungsinteressierte, Naturschutzinteressierte,
Sonntagsausflügler, Touristen, angemeldete Gruppen, bisherige
Besucher des Sihlwaldes, Schulklassen (an diese wendet sich jedoch
weiterhin in erster Linie die bestehende Waldschule), Seminar-
und Tagungsbesucher.
Heutige Nutzer im Sihlwald: [BAUAMT I & STADTFORSTAMT 1989, S.12]
Auch die bisherigen Nutzer des Sihlwaldes sollen angesprochen werden. Diese lassen sich nach den untenstehenden Besuchertypen mit entsprechenden Aktivitäten gliedern:
Auf seiten der Infrastruktur soll ein Schulungsraum für 60 Personen samt Übernachtungsmöglichkeiten/Pensionsbetrieb geschaffen werden.
Es sind sowohl eigene Kursangebote als auch die Vermietung der Räumlichkeiten an externe Veranstalter vorgesehen.
Ziel ist es, dass die Seminar-, Lagerbesucher etc. auschliesslich mit dem öV anreisen, es werden keine Parkplätze zur Verfügung gestellt für mehrtägige Veranstaltungen.
Solche Anlässe finden zudem eher unter der Woche statt oder an Wochenenden ausserhalb der Spitzenzeiten, um Überlastungen zu verhindern.
Nebst den Besuchern hat auch das Personal des Naturzentrums Verkehrsbedürfnisse.
Vorgesehen sind: [CHRISTEN, S. 14]
2./3. Etappe:
Zentrumsleiter (50 Stellenprozente)
Praktikanten, Mitarbeiter des Stadtforstamtes als
Unterstützung
4. Etappe:
Zentrumsleiter (80%)
Hilfskräfte (50%)
5. Etappe (Vollbetrieb):
Zentrumsleiter (100%)
Hilfskräfte, Praktikanten etc.
Waldaufseher
Raumpflege / Unterhalt (20%)
Für die Zukunft ist im Naturzentrum ein eigener Cafeteriabetrieb vorgesehen. Vorerst jedoch besteht in Sihlwald nur das Restaurant Forsthaus. Die Restaurantbesucher sind potentielle Zentrumsbesucher, haben selbst aber auch Verkehrsbedürfnisse. Der Verlauf der Gästezahlen der Wirtschaft kann auch ein Indikator für die Besucherzahlen des Naturzentrums sein. Deshalb stellten wir der Wirtin, Frau Eggenschwiler, folgende Fragen:
a) Belegung der zum Restaurant gehörigen Parkplätze
b) Wäre eine zusätzliche Belegung der Parkplätze durch Besucher des Naturzentrums möglich?
Dies ist unmöglich. Wir haben an schönen Sommertagen jetzt schon zu wenige Parkplätze. Es gibt Stammgäste, die an Sonntagen nicht mehr kommen, da keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Probleme mit Wildparkierern haben wir bereits.
c) Im Falle von gemeinsam genutzten Parkplätzen:
Wenn das Naturzentrum eine Parkgebühr erhebt,
möchten Sie diese Ihren Gästen zurückerstatten?
Falls zusätzliche Parkplätze mit Parkgebühren erstellt würden, gäbe dies natürlich Probleme. Denn wir möchten von unseren Gästen keine Gebühr verlangen. Dies würde aber bedeuten, dass die Leute ihre Autos auf unsere Gratisparkplätze stellen. Ein System mit Rückerstattung der Parkkosten wäre akzeptabel, aber nur, wenn es kaum mit Mehraufwand verbunden ist.
Schätzungen nach BAUAMT I & STADTFORSTAMT
(1989, S. 5)
"Sihlwald ist Ausgangspunkt der Wanderer nach
dem Albishorn über den Spinnerweg, Rundfahrerziel für
Restaurantbesuch, Ausgangspunkt für Promenier- und Lagertyp
entlang der Sihl." [BAUAMT I & STADTFORSTAMT 1989, S.
5ff] Das neue Naturzentrum richtet sich v.a. an den Bildungs-
und Wandertyp.
Anreisende bisher:
| mit PW: | 1200-1500 Besucher pro Tag |
| mit SZU: | 200-300 |
| mit Velo: | 50-100 |
| Total: | 1450-1900 |
Aufteilung nach Erholungstypen:
| Wandertyp: | 230-330 Besucher pro Tag |
| Lagertyp: | 250-310 |
| Rundfahrertyp: | 630-810 |
| Promeniertyp: | 320-400 |
| Sporttyp Sommer: | 20-50 |
| Bildungstyp: | 500-700 (sofern Naturzentrum realisiert) |
M. Christen ging ursprünglich von bis zu 2000 Besuchern im Naturzentrum an Spitzensonntagen aus. Sowohl aufgrund der Schätzungen des BAUAMT I & STADTFORSTAMT (1989) als auch nach den Erfahrungen des Sauriermuseums Aathal korrigieren wir diese Zahl jedoch nach unten auf 500-700 Besucher des Naturzentrums, mit einem eventuellen Maximum von 1000 Personen an Spitzensonntagen, wenn das Zentrum in voller Betriebsphase und bereits einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Für das Verkehrskonzept konzentrieren wir uns auf die zusätzlichen, neuen Besucher des Bildungstyps. Für die bisherigen ist das Verkehrsproblem ja weitgehend gelöst.
Anfänglich werden die Besucher in erster Linie aus der Region stammen, nach und nach soll sich das potentielle Publikum aber nach den Zielvorstellungen auf das ganze Mittelland ausdehnen. Vorerst muss zur Hauptsache mit Besucherströmen aus dem Raum Zürich gerechnet werden.
Im Sauriermuseum Aathal verweilen die Besucher ca. 1.5 Stunden. Da im Sihlwald Spiel- und Verweilmöglichkeiten und auch ein Restaurationsbetrieb vorgesehen sind, setzen wir die Verweilzeit für das Naturzentrum mit 2 Stunden etwas höher an.
Tage:
Spitzenbesuchszahlen sind v.a. an Sonntagen und Samstagen zu erwarten.
Jahreszeit:
Jahreszeitlich stehen Frühling und Herbst im Vordergrund,
im Winter werden am wenigsten Besucher erwartet. Ebenso wird im
Hochsommer während der Ferienzeit kaum mit Spitzenzahlen
zu rechnen sein. Wenn im Berggebiet im Frühling/Herbst noch
beziehungsweise schon wieder Schnee liegt, ist der Sihlwald jedoch
als Ausflugsgebiet ideal. Ziel ist es, mit der Zeit die Spitzen
sowohl im Wochen- als auch im Jahresverlauf auszugleichen (siehe
Beispiel Aathal, Kapitel 6.5.1).
Tageszeit:
Aus der "Sonntagsganglinie Deutsche Schweiz" [VSS 1990, S. 7] geht hervor, dass die Leute für ihre Wochenendaktivitäten einerseits am Vormittag von 10 bis 12 Uhr, andererseits v.a. am Nachmittag von 14-20 Uhr auf den Strassen unterwegs sind. Wir nehmen an, dass der grösste Teil der Besucher am Nachmittag von 14-16 Uhr zu erwarten ist. Über die Mittagszeit wird mit weniger Leuten gerechnet, hingegen trifft evt. am Vormittag von 10-12 Uhr ein relatives Maximum ein.
Im NFP 25 wurden folgende Reisegruppengrössen ermittelt:
Zoo 3.3 Personen.
Krienseregg/Fäkmüntegg: 3.8 Personen [HERZOG ET AL. 1994]
Die Krienseregg ist vorwiegend ein Wandergebiet, naturnah und familienfreundlich, hier werden in erster Linie Familien anzutreffen sein. Im Gebiet um den Zoo sind wohl vermehrt auch Einzelpersonen unterwegs. Das Naturzentrum liegt nun einerseits im Einzugsbereich der Stadt mit vielen Einpersonenhaushalten, andererseits spricht es v.a. Familien an. Es erscheint uns deshalb am plausibelsten, einen Mittelwert der Zahlen für den Zoo resp. der Krienseregg für den Sihlwald anzunehmen, also ca. 3.6 Personen.
Um den Modalsplit einigermassen prognostizieren zu
können, müssen wir uns Gedanken über die öV-Akzeptanz
der potentiellen Besucher machen.
Besitz öV-Abos:
Allgemein besitzen knapp unter 30% der Leute ein Halbtax- oder ein Tarifverbundabo.
Dazu ist jedoch zu sagen, dass sich der Besitz eines
Abos nicht markant auf die Wahl des Verkehrsmittels auswirkt.
Anreise mit privatem Verkehrsmittel:
Folgende Motive werden für eine Anreise mittels Privatverkehr angeführt:
Über 65-Jährige Benützer reisen häufiger per öV als per MIV, da sie eine geringere Autoverfügbarkeit aufweisen, aber von vergünstigten Abos profitieren können.
Frauen benützen häufiger den öV als
Männer - ebenfalls, weil sie weniger über ein Auto verfügen.
Personen, welche als Ausflugsmotiv "Erholung
und Natur" angeben, sind eher zur öV-Benützung
bereit. Personen mit Kindern hingegen führen oft das Argument
an, der öV sei zu teuer oder zu kompliziert, die Flexibilität
mit dem Auto sei wichtiger. Dennoch benützen Familien nicht
häufiger das Auto als der Durchschnitt.
Resultierender Modalsplit im Freizeitverkehr:
Im Durchschnitt weisen alle Besuchergruppen einen
Modalsplit von 55% MIV und 32% öV auf.
Herkunft der MIV-Benützer:
Benützer des MIV stammen v.a. aus:
Herkunft der öV-Benützer:
Diese kommen häufiger aus:
Beispiel MUBA:
Für die Anreise an die MUBA per Zug wird massiv Propaganda gemacht. Wer mit der SBB fährt, erhält einen Gratiseintritt. Zudem besitzt Basel hervorragende IC-Anschlüsse und das Messegelände liegt sehr zentral. Trotzdem wird der Anteil der Bahnreisenden nur auf 40% geschätzt [BASLER ZEITUNG 1996, S. 3].
Nach BAUAMT I & STADTFORSTAMT (1989) sieht der Modalsplit bei den bisherigen Besuchern folgendermassen aus:
Bahn: ca. 16%
PW: ca. 79%
Velo: ca. 5%
Zusammenfassend:
Der durchschnittliche Freizeitverkehr setzt sich aus 55% MIV und 32% öV zusammen.
An die MUBA reisen ca. 40% der Besucher per Bahn.
Im Aathal benützen ca. 70% das Privatauto.
Bisher reisten ca. 79% der Personen mit dem Auto
in den Sihlwald.
Aufgrund dieser Feststellungen ist es nun unser Ziel, einen öV-Anteil von 50% zu erreichen. Gründe für diesen relativ hohen öV-Anteil sind:
Zudem soll der Anteil der Velofahrer und Fussgänger
gesteigert werden auf ca. 7% mittels der verbesserten Velowege,
evt. durch die Möglichkeit, am Bahnhof Sihlbrugg Velos zu
mieten.
So resultiert folgender Modalsplit:
50% öV
43% MIV
7% Velofahrer und Fussgänger
Unsere Vorstellung wäre eigentlich, 100% der Besucher für eine Anreise ohne Auto zu gewinnen. In Realität wird dies jedoch nicht zu schaffen sein, denn erstens sind auch die zufällig vorbeifahrenden Autofahrer ein potentielles Zentrumspublikum, und zweitens wird es immer Leute geben, die trotz Nichtvorhandenseins von Parkplätzen per MIV anreisen. Wir denken jedoch, dass wir mit dem obenstehenden Modalsplit relativ hohe Ansprüche an die Besucher stellen und so auch eine quasi "erzieherische" Funktion übernehmen.
Da wir u.E. also nicht von 100% öV-Benützern
ausgehen können, müssen wir uns zwangsläufig Gedanken
zur Bewältigung des Autoverkehrs und somit zu allenfalls
benötigten Parkplätzen machen.
Gemäss den Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute VSS werden pro Arbeitsplatz im Dienstleistungsbereich 0.6 Parkfelder, mindestens aber 1 Parkfeld pro Betrieb benötigt [VSS 1990, S. 8].
Dies bedeutet für uns: 1 Parkfeld für das
Personal. Auch das Personal ist angehalten, die SZU zu benützen.
Reinigungspersonal ist erst tätig, wenn das restliche Personal
schon weg ist.
Bei Gastbetrieben ist gemäss VSS 1 Parkfeld pro 6 Sitzplätze nötig bei mittlerem Anteil der Kundschaft, welche per Auto anreist. In ländlichen Regionen kann der Wert bis auf 1 Feld pro 3 Sitzplätze steigen [VSS 1993, S. 3].
Das Restaurant Forsthaus weist für seine 90
Sitzplätze (60 im Restaurant, 30 im Säli, Gartenwirtschaft
für 300-400 Personen) 26 Parkplätze auf. Sie sind somit
gemäss VSS-Normen theoretisch relativ gut dotiert (für
90 Sitzplätze wären mit dem Wert von 3 Sitzplätzen/1Parkfeld
30 Parkplätze nötig, mit dem niedrigeren Wert von 6
Gästen pro Feld nur 15).
Leider macht die VSS keine Angaben zu Stätten,
welche mit dem Naturzentrum vergleichbar wären. VSS-Normen
zu den Parkplatzwerten sind nach unserem Wissen im allgemeinen
relativ hoch angesetzt.
Beim Sauriermuseum in Aathal sind 100 Parkplätze
für heute ca. 400 Besucher pro Tag vorhanden, d.h. 1 Parkplatz
für 4 Besucher. Die 400 Besucher sind auf eine Öffnungszeit
von 7 Stunden verteilt. Im Durchschnitt sind so 57.14 (400 Besucher
: 7 h Öffnungsdauer) * 1.5 h (Verweilzeit) = 85.17 Besucher
ungefähr gleichzeitig im Museum. Dies bei einem Auto-Benützer-Anteil
von 70%.
Für das Naturzentrum:
| Annahmen: | 700 Besucher |
| 2 Stunden Verweilzeit | |
| 43% Besucher mit Auto | |
| 7 Stunden Öffnungszeit | |
| Reisegruppengrösse: 3.6 Personen | |
| 700 : 7 * 2 h = 200 Besucher innerhalb einer Stunde, d.h. ungefähr gleichzeitig. |
Davon reisen 43% = 86 Personen mit dem Auto an. Befinden
sich in jedem Auto 3.6 Personen, so ergäbe dies ca. 24 PW's
pro Stunde. Dieser Wert kann nun aber nicht direkt als Parkplatzzahl
genommen werden, denn die Besucher sind nicht gleichmässig
auf 7 Stunden verteilt. Am Vormittag und vor allem ab 14 Uhr ist
mit Spitzenwerten zu rechnen. Nehmen wir nun an, es kämen
zu Spitzenzeit dreimal so viele Leute wie im Durchschnitt, so
müssten wir mit 72 PW's (Spitzenbedarf) rechnen.
Andere Berechnungsvariante:
Berücksichtigen wir den Wert vom Sauriermuseum
von 0.25 Parkplätzen pro Besucher, so ergäbe dies eine
benötigte Parkfeldzahl von 175. Dieser Wert ist aber für
das Naturzentrum zu hoch, da wir einen anderen Modalsplit erreichen
möchten. Auf unseren Modalsplit (43% MIV) umgerechnet, würden
dies noch 107.5 Parkplätze bedeuten. Im Vergleich zum Aathal,
wo jeder Besucher über 0.25 Parkplätze verfügt,
bestünden so im Sihwald für jede Person nur 0.154 Parkfelder
(= 6.5 Personen pro Parkplatz).
Die Werte (Aathal von 4 Besucher pro Parkplatz, Sihlwald nach 2. Berechnungsvariante 6.5) im Vergleich:
VSS-Normen für
| Hallenbäder: 1 Parkfeld für | 3-7 Besucher |
| Freibäder: | 3-6 Besucher |
| Kunsteisbahnen: | 5-9 Eisbahnbenützer oder 2-5 Zuschauerplätze [VSS 1993, S. 7-8]. |
Solche Anlagen liegen jedoch meist in Zentrumsgebieten im Gegensatz
zum Naturzentrum. Wir würden jedoch mit unserem Wert gut
innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegen.
So nehmen wir denn einmal an, die benötigten Parkplätze lägen zwischen den oben - auf zwei verschiedene Arten - berechneten Werten von 72 resp. 107.5 Parkplätzen. Es resultieren so ca. 90 Parkplätze.
Ein Uebersichtsplan befindet sich im Anhang 6.11.1
Sihlwald ist zu Fuss von allen Richtungen her gut erschlossen.
| täglich | Sa, So | |
| Zürich HB | ab xx.33 | ab 15.03 16.03 17.03 |
| Sihlwald | an xx.58 | an 15.28 16.28 17.28 |
| Sihlbrugg | an xx.04 | an 15.34 16.24 17.24 |
| täglich | nach | von |
| Horgen Oberdorf | ab xx.42 | an xx.14 |
| Zug | ab xx.14 | an xx.42 |
| täglich | von | nach |
| Zug | an xx. 42 | ab xx.14 |
| Horgen Oberdorf | an xx.14 | ab xx.42 |
| Mo-Fr | Sa, So | Sa, So | |
| Sihlbrugg | ab xx.16 | ab xx.25 | 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 |
| Sihlwald | ab xx.19 | ab xx.29 | 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 |
| Zürich HB | an xx.46 | an xx.56 | 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 |
| Mo-Fr | Sa. So | |||
| PTT | TROL | PTT | TROL | |
| Hausen | ab xx.22 | ab xx.22 | ||
| Langnau | an xx.41 | an xx.41 | ||
| Langnau SZU | ab xx.56 | ab xx.56 | ||
| Sihlwald | an xx.58 | an xx.58 | ||
| Mo-Fr | Sa. So | |||
| PTT | TROL | PTT | TROL | |
| Thalwil | ab xx.04 | ab xx.25 | ab xx.04 | ab xx.45 |
| Langnau | an xx.16 | an xx.36 | an xx.16 | an xx.57 |
| Langnau SZU | ab xx.56 | ab xx.56 | ab xx.56 | ab xx.56 |
| (15.26 16.26 17.26) | ||||
| Sihlwald | an xx.58 | an xx.58 | an xx.58 | an xx.58 |
Sihlwald ist mit dem Auto sehr gut erreichbar. An der Zählstelle für die Sihltalstrasse in Sihlbrugg werden täglich rund 19'000 Autos gezählt.
1994: an Werktagen 18'938, am Samstagen 19'045, am Sonntagen 18'238.
Ein Übersichtsplan befindet sich im Anhang 6.11.2
Für die Autofahrer existieren in Sihlwald 83 Gratisparkplätze:
Diese Parkplätze werden bereits heute an schönen Wochenenden vollständig genutzt. Die Parkplätze bei der Sihlwaldschule sind täglich gut ausgelastet, da Spaziergänger, die in den Zimmerberg oder der Sihl entlang gehen, zuerst diese benutzen. Die Parkplätze beim Bahnhof sind unter der Woche nie vollständig belegt. Vereinzelt werden sie als P+R von Innerschweizern genutzt. Bei vollständiger Auslastung an Sonntagen wird die Strasse neben dem Restaurant zusätzlich als "wilder" Parkplatz genutzt. Dies sind nochmals rund 10 inoffizielle Parkplätze.
Carparkplätze existieren keine. Sowohl beim
Restaurant, als auch beim Bahnhof kann ein Car auf Kosten einiger
PWs abgestellt werden.
Anhand unserer Besucherzahlen und der bestehenden Infrastruktur lassen sich folgende Konfliktpunkte, die es zu lösen gilt, erkennen:
Das Zentrum ist sowohl vom Sihluferweg als auch vom
Sihlwald her nur über einen Umweg beim Restaurant vorbei
erreichbar. Beim Zentrum sollte eine neue Passerelle erstellt
werden, die Bahn und Hauptstrasse überquert. Über die
Sihl muss eine einfache Brückenlösung gesucht werden.
Verbesserungsvorschläge:
(Gespräch mit Herrn Bieler vom Amt für
Gewässerschutz, Abt. Gewässerunterhalt)
Um einen Übergang vom Fuss- und Veloweg am rechten Sihlufer zum Naturzentrum zu schaffen, wäre die Möglichkeit eines Schwemmsteges zu prüfen. Schwemmstege erlauben es den Fussgängern, den Fluss auf etwas abenteuerlichere Art und Weise, aber trotzdem trockenen Fusses, zu überqueren.
Schwemmstege gibt es im Tösstal an drei Orten:
In Bauma, Turbenthal und Kollbrunn. Sie wurden vom Amt für
Gewässerschutz erstellt (Herr Bieler). Aus alten Chroniken
wusste man, dass früher solche einfachste Stege existiert
haben müssen, als die Töss noch nicht verbaut war. Pläne
zu diesen Überquerungsmöglichkeiten sind jedoch nicht
vorhanden. Herr Bieler entwickelte die Stege nur nach vagen historischen
Angaben.
Prinzip des Schwemmsteges:
Er besteht aus zwei massiven Planken, wobei jede
auf einer Seite am Ufer an einem Pfahl (geschützt mit einer
Eisenmanschette) mit einem Eisenrohr (Gelenk) befestigt ist. In
der Mitte der Töss befindet sich ein dritter Pfosten, wo
die Planken zusammentreffen. Die Planken sind nur an ihren seitlichen
Enden fest verankert. Wenn nun der Wasserstand steigt (bei der
Töss 1.5 - 2 m), werden die Planken zur Seite geschwemmt,
der Steg ist nun nicht mehr begehbar, bildet aber auch kein Hindernis
mehr für das Hochwasser. Nach Abschwellen des Wassers können
die Planken mittels Winde wieder in die Mitte gezogen werden.
Die Planken sind nur knapp über Wasser angelegt (je tiefer,
desto sicherer: sie werden umso früher weggeschwemmt, ein
gefährliches Überqueren bei hohem Wasserstand wird so
unmöglich).
Abb. 1: Darstellung eines Schwemmsteges.
Kosten:
Bei der Töss:
10'000 bis 15'000 Franken. Die Töss ist ca.
25 m breit, der Pegel steigt um 1.5-2 m.
Machbarkeit bei der Sihl:
Im Prinzip wären unendlich lange Stege denkbar. Längere Stege müssten evt. 3-4-feldrig angelegt werden, Herrn Bieler fehlt aber die Erfahrung zu längeren Stegen.
Die Kosten könnten massiv gesenkt werden durch Erstellen des Steges in Eigenregie/Fronarbeit durch das Naturzentrum (z.B. Schülerlager?). Das Zurückziehen der Stege nach Hochwasser müsste wohl durch das Naturzentrum geschehen (Töss: Arbeiter des Gewässerschutzamtes erledigen diese Aufgabe). Das Amt für Gewässerschutz selbst hat kein Interesse, solche Stege auch an der Sihl zu erstellen. Herr Bieler wäre jedoch bereit, sein Wissen weiterzuvermitteln und die Stege im Tösstal näher zu erläutern. Im Falle einer Realisierung eines solchen Überganges müsste eine Bewilligung beim Amt für Gewässerschutz eingeholt werden.
Die Verbindung Zürich über Sihlwald nach Sihlbrugg sollte durchgehend beschildert werden. Verbesserungsvorschläge:
An den Wochenenden ist ein Stundentakt keine optimale benutzerfreundliche Erschliessung.
In Sihlwald stehen zu wenig Parkplätze zur Verfügung. Es kommt zu Nutzungskonflikten zwischen bisherigen und neuen Besuchern. Die Strasse beim Restaurant und in Richtung Horgen wird noch vermehrt zum Wildparkieren benutzt. Auch die beiden Ausstellplätze beim Sihlknie zwischen Langnau und Sihlwald werden als Parkplätze genutzt, obwohl die Hauptstrasse dort gefährlich zum Überqueren ist. Durch Parkplatzsucher kann es ohne Gegenmassnahmen im schlimmsten Fall zu Rückstaus auf die Hauptstrasse kommen.
Die geplanten Aktivitäten des Vereins Zürcher
Museumsbahn werden in Sihlwald ebenfalls zu einer Erweiterung
des bisherigen Benutzerkreises führen. Da sich dieser Verein
bis anhin noch keine Gedanken zum Anreiseverhalten seiner Besucher
gemacht hat, ist es sinnvoll, gemeinsam mit diesem ein Parkplatzkonzept
zu realisieren.
Auto-Parkplätze:
Unter der Annahme eines Modal-Splits von 43% öV-Benützern
muss mit maximal 90 Autos zu Spitzenzeiten gerechnet werden. Das
bestehende Parkplatzangebot in Sihlwald genügt an schönen
Sonntagen nicht, da weiterhin mit den bisherigen Erholungssuchenden
gerechnet werden muss. Vermutlich nur ein kleiner Teil der bisherigen
Parkplatzbenützer wird gleichzeitig noch das Zentrum besuchen.
Um ein Verkehrschaos zu verhindern, bieten sich folgende Lösungsvorschläge
(teilweise in Kombination miteinander) an:
Carparkplätze:
Um an Spitzentagen das beschränkte Parkplatzangebot nicht noch zusätzlich durch Cars zu verkleinern, empfiehlt es sich, für Cars in solche Fällen eine spezielle Lösung zu treffen. Da Cars einen grossen Wendekreis benötigen, wäre es nützlich, sie auf dem Buswendeplatz neben der Station kehren und anschliessend auf der alten Sihltalstrasse zum Beispiel auf der Bushaltestelle parkieren zu lassen.
Auf der Suche nach mit dem Naturzentrum vergleichbaren Einrichtungen stiessen wir einerseits auf das Sauriermuseum Aathal, andererseits auf den Zoo.
Aus folgenden Gründen zogen wir das Sauriermuseum als Beispiellösung heran:
Fragen ans Sauriermuseum Aathal:
Interview telefonisch mit Herrn Waech, 29.2.96
Öffnungszeiten: Di-So, 10-17 Uhr
Tel.: 01 932 14 18
Vorbemerkungen: Die Ausstellung wurde 1992 als temporäre
Schau ins Leben gerufen. Die Betreiber kämpfen ebenfalls
ständig um Geld. Alles ist seit Beginn weg provisorisch,
so auch ihre Verkehrslösungen.
1. Wer sind Ihre Besucher?
2. Wie kommen die Besucher?
3. Wieviele kommen?
4. Wann kommen sie?
5. Wie lange verweilen sie durchschnittlich in der Ausstellung?
6. Besteht ein Verkehrskonzept?
7. Besteht ein Marketingkonzept?
8. Gibt es Probleme?
9. Wie hoch ist der Eintrittspreis?
10. Wie sieht die bestehende Infrastruktur bezüglich öffentlicher Verkehr aus?
Der Zoo wurde als Beispiellösung gewählt, weil er ebenfalls in einem Naherholungsgebiet liegt und sich so auch Nutzungskonflikte mit anderen Besuchergruppen dieses Gebietes ergeben. Nicht vergleichbar hingegen sind die Besucherzahlen.
Maximal 30 Tage im Jahr sind für den Zoo Spitzentage mit über 5000 Besuchern. An diesen Tagen, ausschliesslich Sonn- und Feiertage, bestehen für Besucher, welche mit dem Auto anreisen, Schwierigkeiten, das Auto in der Nähe des Zoos zu parkieren [MARKETINGKONZEPT ZOO 1996, S. 2].
Nur etwa die Hälfte des Besucheraufkommens im
Raum Zoo geht zu Lasten der Zoobesucher. An Spitzentagen liegt
der Modalsplit bei den Zoobesuchern bei einem Drittel öV-
und zwei Dritteln Auto-Benützern. Bei Sonderausstellungen
konnte der öV Anteil auf 40% gesteigert werden. Die übrigen
Erholungssuchenden verzeichnen einen tieferen Autoanteil, da sie
meist aus der näheren Umgebung stammen.
| Benutztes Verkehrsmittel | Zoobesucher Spitzentag | Zoobesucher Sonderausstellung | Übrige Erholungssuchende |
| Öffentlicher Verkehr | 30 - 35% | 40% | 35 - 40% |
| Auto | 60 - 65% | 60% | 50% |
| Fussgänger ,Velo | < 5% | < 5% | 10 - 15% |
Parkplatzbewirtschaftung:
An besucherreichen Tagen wird die Zuweisung des Autoverkehrs auf die Parkplätze durch Verkehrskadetten geregelt. Die Kosten dafür trägt der Zoo. Wenn alle Parkplätze im Bereich des Zoos aufgefüllt sind, werden die Autofahrer zum Dolderparkplatz weitergeleitet. Von dort gibt es je nach Bedarf einen durch die Verkehrskadetten abrufbaren Shuttle-Bus, der im Halbstundentakt zum Zoo verkehrt. Auch diese Kosten trägt der Zoo.
Mit einem neuen Marketing soll versucht werden, den Modalsplit zugunsten des öVs zu verbessern.
Im Sinne einer rollenden Planung müssen die
einzelnen Massnahmen den ständig wachsenden Bedürfnissen
angepasst werden. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit den übrigen
zukünftigen Betreibern von Angeboten in Sihlwald eine unabdingbare
Voraussetzung, um für alle Beteiligten Kosten, Nutzten und
menschliche Energien möglichst optimal einzusetzen. Dazu
gehört ein aufeinander abgestimmtes Marketingkonzept so gut
wie ein gemeinsames Verkehrs- und vor allem Parkplatzkonzept.
1. Etappe 1996
| Massnahme | Partner | Kompetenz | Kontaktperson | Kosten |
| Beschilderung Fussweg Station-Zentrum | SZU | Stiftung | ||
| Signalisation Zentrum | ||||
| In Werbung vermitteln, dass in Sihlwald keine P vorhanden. | Marketing-berater | Stiftung |
2. Etappe 1997
| Massnahme | Partner | Kompetenz | Kontaktperson | Kosten |
| Fussgängerbrücke über Sihl | AGW | AGW | Hr. Bieler | Fr. 10'000 |
| Veloparkplätze im Zentrum | Stiftung | |||
| Parkplatzgebühren | SZU, Restaurant, Gmd. Horgen, Oberrieden | SZU, Stiftung | Hr. Hehli SZU
Hr. Burri Horgen Hr. Bänninger Oberrieden | Fr. 15'000 |
| evt. erste provisorische Parkplätze entlang der Geleise | Museums-
bahn |
3. Etappe 1998
| Massnahme | Partner | Kompetenz | Kontaktperson | Kosten |
| Passerelle über Bahn und Strasse beim Zentrum | ||||
| Halbstundentakt SZU ab 11 Uhr | SZU,
Museums-bahn | ZVV | Hr. Gross | |
| Provisorische Parkplätze entlang der Geleise | ||||
| evt. Einsatz von Verkehrskadetten | Museums-
bahn |
4. und 5. Etappe 1999-2000
| Massnahme | Partner | Kompetenz | Kontaktperson | Kosten |
| P+R Anlage in Sihlbrugg | SZU/SBB | SBB | Hr. Kümmin | |
| Bikevermietung in Sihlbrugg | Privat, SZU | |||
| Kombibillette | ZMB, SZU,
SBB | ZVV |
Von unserer ursprünglichen Vorstellung, dass der Besucherverkehr zu 100% per öV abgewickelt und keine Parkplätze erstellt werden sollten, mussten wir im Verlaufe unserer Arbeit abrücken, wenn auch schweren Herzens. Auch unsere anfängliche Begeisterung für die Park+Ride-Variante wurde in mehreren Gesprächen relativiert. Die Möglichkeit, in Sihlwald Parkplätze in variabler Zahl auf unversiegeltem Boden flexibel zur Verfügung stellen zu können, und zwar gegen Entgelt, erscheint uns aber eine akzeptable Lösung. Der Ausschlag zu dieser Variante gab v.a. auch die Tatsache, dass durch die ZMB u.E. zusätzlicher Verkehr entstehen wird, womit die Kapazitäten in Sihlwald endgültig überlastet wären. Nicht vergessen werden darf auch, dass bei der Eingabe von Baubewilligungsgesuchen die Anzahl Parkplätze wohl kritisch begutachtet werden wird. Wichtig ist uns aber Flexibilität - das Verkehrsaufkommen muss laufend beobachtet und das allfällige Parkplatzangebot den Bedürfnissen angepasst werden. Hierzu ist unbedingt auch die Zusammenarbeit mit dem Wirt und der ZMB vonnöten. Nach wie vor aber steht der Naturlandschaftsgedanke im Vordergrund - die Leute sollen zu einer umweltfreundlichen Anreise angehalten und auch "erzogen" werden. Es soll keine vorsorgende Nachfrageplanung nach Spitzenbedarf betrieben werden, aber man muss auf Überlastungen vorbereitet sein und ein Chaos verhindern können dies nicht zuletzt aus Imagegründen.
| Gemeinde Horgen: | |
| Herr Burri, Bausekretär | 728 43 02 |
| Herr Haas, Gemeindeingenieur | 728 43 13 |
| Gemeinde Oberrieden | |
| Herr Bänninger, Bausekretär | 722 71 28 |
| Kantonales Amt für Gewässerschutz | |
| Abt. für Gewässerunterhalt, Hr. Bieler | 259 31 51 |
| Kantonales Amt für Raumplanung | |
| Hr. Rechsteiner | 259 30 48 |
| Hr. W. Meier, Wanderwege | 259 30 41 |
| Hr. M. Graf, Naturschutz | 259 43 63 |
| Kantonales Tiefbauamt Adliswil | |
| Herr Hürlimann | 710 64 10 |
| Herr Aerni, Strassenverwalter Wädenswil | 780 51 65 |
| Herr Eisler, Verkehrszählungen | 816 37 54 |
| Kantonspolizei Zürich | |
| Herr Büchi, Sonderveranstaltungen | 247 37 61 |
| Herr Gradwohl | |
| Restaurant Forsthaus, Sihlwald | |
| Familie Eggenschwiler | 720 03 01 |
| Sauriermuseum Aathal, Herr Waech | 932 14 18 |
| SBB | |
| Hr. Koch, Horgen Oberdorf | 725 44 30 |
| SBB Kreisdirektion | |
| Hr.Marti, Güterverkehr | 051 222 11 11 |
| Hr. Kümmin, Liegenschaftenvermarktung | 051 222 24 29 |
| Stadtplanungsamt Zürich | |
| Herr Würth | 216 27 36 |
| SZU | |
| Herr Gross, Produktion | 206 45 20 |
| Herr Hehli, Marketing | 206 46 21 |
| Vereinigung Pro Sihltal | |
| Heinz Binder, ZAW Sihlbrugg | 725 25 73 |
| Zürcher Museumsbahn ZMB, Herr Biletter | 915 28 38 |
| Zoo, Herr Müller | 261 31 24 |
Basler Zeitung, 8. März 1996, S.3.
Bauamt l und Stadtforstamt der Stadt Zürich
(durchgeführt von Hesse und Schwarze und Partner), 1989:
Erholung in der Naturlandschaft Sihlwald - Analyse und Wertung
der bestehenden privaten und öffentlichen Nutzungen des Sihlwaldgebietes.
Zürich.
Christen, M., 1996: Stiftung Naturlandschaft Sihlwald:
Projekt Naturzentrum Sihlwald.
Christen, M., Casanova, R.: Zielvorstellungen für
das Naturzentrum Sihlwald.
Christen, M.: Naturzentrum Sihlwald - Leitgedanken.
Herzog, S. et al., 1994: Freizeit-Freizeitverkehr-Umwelt
- Tendenzen und Beeinflussungsmöglichkeiten. NFP 25. Bericht
58 A u. B.
Institut f. Verkehrsplanung, Transporttechnik, Strassen-
und Eisenbahnbau ETHZ, 1994: Verkehrskonzepte, Vorlesungsunterlagen.
Zürich.
Interkantonales Technikum Rapperswil, Abt. Landschaftsarchitektur,
1994: Erholungskonzept Nationalpark Naturwald Sihlwald. Rapperswil.
Oekozentrum Zürich, 1993: Umweltschonende Grossveranstaltungen,
Referate an der Tagung vom 26. Mai 1993. Zürich.
Stadtplanungsamt Zürich, 1995: Entscheidungsgrundlagen
zur zukünftigen Zooerschliessung - Handlungsempfehlungen
der Arbeitsgruppe "Verkehrskonzept Zoo".
SZU, 1996: Gedanken zur Sihltal-Nostalgie. Zürich.
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute VSS,
1990: Schweizer Norm 641 230a Ganglinientypen und durchschnittlicher
täglicher Verkehr. Zürich.
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute VSS,
1993: Schweizer Norm 641 400 Parkieren resp. Parkieren - Erfahrungswerte.
Zürich.
Zoo Zürich, Januar 1996: Marketingkonzept.
Zoo Zürich: Verkehrskonzept.