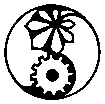
BGU Beratungsgemeinschaft für Umweltfragen Dreikönigstrasse 49 CH-8002 Zürich Telefon: 01/2024065
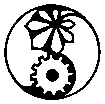
Datum: Oktober 1988 Bearbeiter: Dr. Susanna Züst Richard Stocker Martin Küper
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
B. Berichte
1. Die Waldgesellschaften und ihre Standorte
l.1. Zur Kartierung
1.2. Methode
1.2.1. Zur Methode der Pflanzensoziologie samt Kartierungs-
schlüssel
1.2.2. Die Entstehung einer Standortskarte
1.3. Die Waldgesellschaften und Standorte im Ueberblick
1.3.1. Geologie und Klima
1.3.2. Kommentar zur Vegetationskarte
1.3.3. Die Waldgesellschaften im Sihlwald bezogen auf jene
der Region, des Kantons Zürich und der Schweiz
1.3.4. Flächenvergleich der Waldgesellschaften Kanton Zürich /
Region / Sihlwald
1.3.5. Die Beschreibung der einzelnen Waldgesellschaften
2. Die Naturnähe der Waldbestände
2.1. Zur Kartierung
2.2. Bewertung der Resultate
3. Waldfreie Standort
3.1. Die Kartiermethode
3.2. Beschreibung der Bestandestypen waldfreier Standorte
3.3. Die Bewertung der waldfreien Standorte
4. Die Waldränder
4.1. Die Kartierung der Waldränder
4.2. Der Schlüssel zur Waldrandkartierung
4.3. Resultate
5. Bestände mit erhöhter Strukturvielfalt (=Psychotope)
5.1. Auswahlkriterien für die Gebiete und Beschreibungsweise
5.2. Die Beschreibung der 26 Gebiete von erhöhter Strukturvielfalt
5.3. Die Beurteilung der Gebiete
6. Ausblick
7. Unterlagen und Literatur
Das Stadtforstamt der Stadt Zürich erwägt, seine Waldungen im Sihlwald langfristig in eine Naturlandschaft vor den Toren der Stadt Zürich überzuführen. Die Idee des Projektes "Naturlandschaft Sihlwald" wurde 1986 der Oeffentlichkeit vorgestellt. Herr Stadtforstmeister Speich gelangte im selben Jahr mit der Aufgabe an die BGU, im Sihlwald die Vegetation samt weiterer Strukturen, die zur biologischen Vielfalt beitragen, zu bearbeiten (Studienbereich A). Im Dezember 1987 wurde unser Pflichtenheft in diesem Sinne überarbeitet. Es galt, den Ist-Zustand zu erfassen und Vorstellungen zum Natur-Potential im Sihlwald herauszuschälen.
Während dieser ersten Projektphase lud der Stadtforstmeister und sein Betreuer dieses Projektes, Dr. M. Broggi dreimal zu einem fachübergreifenden, tägigen Seminar ein. An diesen Anlässen informierte er die Bearbeiter sämtlicher Studienbereiche über den Entwicklungsstand des Projektes "Naturlandschaft Sihlwald" und liess die Beauftragten der verschiedenen Studienbereiche über den Stand ihrer Erhebungen, Gedanken und Perspektiven zum Projekt berichten.
Die Wälder im Kanton Zürich wurden durch die BGU und Mitarbeiter im Auftrage des Oberforstamtes des Kantons Zürich und des Amt für Raumplanung Zürich in den Jahren 1983 bis 1988 vegetationskundlich kartiert.
Im Rahmen dieser Arbeiten wurden 1986/87 die Wälder im Sihlwald durch T. Burger, M. Küper, P. Schmid und R. Stocker kartiert. In Anbetracht des Projektes "Naturlandschaft Sihlwald" wurde hier jedoch kleinflächiger gearbeitet als im übrigen Kanton.
Die Vegetation kann etwas vereinfachend als ganzheitlicher Ausdruck des Standortes angesehen werden. Man kann zeigen, dass bei Kombinationen von gleichartigen Standortsbedingungen in zusammenhängenden Gebieten stets etwa die gleichen Pflanzenarten gemeinsam gedeihen. Einzelne unter ihnen treten bei bestimmten Standortsbedingungen besonders regelmässig auf. Die einen zeigen zuverlässig an, dass es z.B. besonders luftfeucht ist; andere weisen uns etwa auf ein gutes Nährstoffangebot im Boden hin. Solche Arten nennt man Zeigerpflanzen. In der Natur treten meistens mehrere Zeigerpflanzen mit ähnlicher Aussage gemeinsam auf. Die Pflanzensoziologie macht sich diese Erscheinung zu Nutze, indem sie charakteristische Kombinationen solcher Zeigerpflanzen-Gruppen systematisch erfasst und einer bestimmten Pflanzengesellschaft zuordnet. Eine Pflanzengesellschaft umschreibt somit auf ganzheitliche Weise die wesentlichen Standortsfaktoren eines Oekosystems.
Zur Bestimmung einer Pflanzengesellschaft bedienen wir uns einesVegetations- und Kartierungsschlüssels, der jeweils nur für ein geographisch begrenztes Florengebiet gelten kann. Wir benutzten den Kartierungsschlüssel für den Kanton Zürich (siehe Abb. 1). Darin sind vertikal die Zeigerpflanzen-Gruppen und horizontal die Pflanzengesellschaften systematisch aufgelistet. Einer bestimmten Kombination von Zeigerpflanzen-Gruppen entspricht eine definierte Einheit.
Bei der Bestimmung der Pflanzengesellschaften im Walde interessiert uns in der Regel nicht die aktuelle, sondern die potentielle Bestockung. Denn nur sie ist ja Ausdruck der naturgegebenen Standortseigenschaften. In bewirtschafteten Wäldern geben uns darum oft nur Moos-, Kraut- und Strauchschicht darüber zuverlässige Auskunft.
Die Vegetation ist - wie beschrieben - lebendiger und ganzheitlicher Ausdruck des komplexen Gefüges der Standortsfaktoren. Wir bezeichnen daher die Karte, welche das Mosaik der Pflanzengesellschaften nach obiger Methode erfasst, als Standortskarte. Sie wird erarbeitet, indem man die Wälder systematisch in Streifen abschreitet. Dabei wird versucht, jede Veränderung von Vegetation und Standort wahrzunehmen. Im Vordergrund der Beobachtung stehen Topographie, Gesamtaspekt der Bestände und v.a. das Auftauchen oder Verschwinden wichtiger Vertreter der Zeigerpflanzen-Gruppen des für das Gebiet erarbeiteten Kartierungsschlüssels.
Zeigt die Vegetation veränderte Bedingungen an, so gilt es, die neue Pflanzengesellschaft anhand des Kartierungsschlüssels zu analysieren und gleichzeitig die Grenze zum vorher durchschrittenen Standortauszumachen. Letztere kann scharf oder fliessend sein, was auf dem Plan durch entsprechende Signaturen zu kennzeichnen ist. Gearbeitet wurde mit Feldplänen 5000. Die mosaikartige Karte entstand, indem bei jedem Durchgang die Grenzen der Einheiten sinnvoll mit denjenigen des vorigen Durchgangs verbunden wurden. Als Einheit wurden Flächen von einer Ausdehnung von 25 x 25m noch erfasst.
Der Sihlwald liegt an den Abhängen der Albis- und Zimmerbergkette; Formationen mit Rutschungen und Sackungen der oberen Süsswassermolasse prägen das Gebiet. Die weniger steilen Partien des Zimmerberges sind überdies überdeckt von Würmmoränen des Lindthgletschers.
Mit der tiefsten Lage von ca. 470 m ü.M. an der Sihl Langnau und der höchsten auf der Bürglen 914 m ü.M. befindet sich der Sihlwald in der Uebergangszone von der submontanen zur montanen Klimazone. Unter Berücksichtigung des Talcharakters und der generellen nordostexposition sowie in Richtung Voralpen zunehmenden Niederschlagsmenge herrschen im Sihlwald im allgemeinen Klimaverhältnisse der unteren Montanstufe.
Im Sihlwald wurden auf Eigentumsgebiet der Stadt Zürich genau 1'000 ha Wald mit 54 Vegetationseinheiten kartiert (siehe gleichlautender Plan Nr. 1).
Beim Ueberblicken der Karte fallen dem Betrachter einerseits die grossflächigen, nährstoffreichen Waldgesellschaften 7, 8, 11 und 12 auf (Waldmeister-Buchenwald, Waldhirsen-Buchenwald, Aronstab-Buchenwald, Zahnwurz-Buchenwald). Sie befinden sich zum grössten Teil auf den "Böden"; vom Hüllilooboden bis zum Streuboden und vom Rosspaltiboden zum Kellerboden.
Andererseits entstanden entlang der steilen Flanken des Albisgrates sowie in den Erosionsfächern der Bäche kleinflächige Mosaike mit Waldgesellschaften auf instabilen Böden.
Bedingt durch geomorphologische Bewegungen sind die Waldgesellschaften in Langnau vielfältiger als auf Horgener Gemeindegebiet.
Die Abhänge des Zimmerbergs sind auf Grund ihrer Exposition wärmer als die Albisseite. Dies zeigt sich im Auftreten von Seggen-Buchen- (14, 15) und Föhrenwäldern (61, 62). Zwischen Thalwil und Oberrieden gehen die Wälder auf dem Zimmerberg von der submontanen in die montane Klimazone über.
Im Randbereich hat der Sihlwald noch Anteil an den ausgedehnten und zahlreichen Feuchtstandorten des Zimmerbergs: Seltene Bruchwälder mit Hochmooraspekt säumen das Langenmoos.
Die Waldstandorte im Sihlwald sind im allgemeinen äusserst nährstoffreich, was an der üppigen Bodenvegetation und dem gestreckten Wuchs der Laubbäume ablesbar ist. Diese ungewöhnliche Fruchtbarkeit ist durch das basen- und nährstoffreiche Muttergestein, die gute Wasserversorgung der Böden und das ausgeglichene Klima bedingt.
Im Sihlwald haben sich auf den mit Nährstoffen und Wasser optimal versorgten Böden die Waldmeister- und Waldhirsen-Buchenwaldgesellschaften 7 und 8 angesiedelt. Sie beanspruchen einen Waldflächenanteil von 50%.
Die frischen bis feuchten, kalkreichen Lungenkraut-, Aronstab- und Zahnwurz-Buchenwälder 9, 11 und 12 nehmen eine Fläche von 30% ein.
Fast 10% der Waldfläche beherbergen Eschen-, Erlen- und Fichten-Birken-Waldgesellschaften 26, 27, 30, 44 und 45, auf feuchten bis nassen, grösstenteils nährstoffreichen Standorten. Auf den weniger bindigen, schluffigen Böden findet man wechseltrockene bis wechselnasse Standorte mit den Waldgesellschaften 10w, 12w, 14w, 15w, 17, 26w, 27w sowie 61 und 62. Diese nehmen eine Fläche von mehr als 20% ein.
Von den 67 im Kanton Zürich ausgeschiedenen Vegetationseinheiten sind auf dieser Fläche deren 54 zu finden. Nicht vertreten sind namentlich die auf warme kolline Lagen beschränkten Eichenwälder, die Föhrenwälder des Juras (Lägern), sowie die nassen, sauren, nährstoffarmen Standorte.
Zur typischen Ausbildung der Waldgesellschaften: Das Waldgebiet ist v.a. auf Horgener Gemeindegebiet mit standortsheimischen Bäumen bestockt. Diese Voraussetzung trägt dazu bei, dass sich die Boden- und Strauchvegetation in den Baum- und Altholzbeständen standortsgemäss ausbilden kann. Im Vergleich mit den Artenkombinationen des Atlas über die "Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz" von H. Ellenberg und F. Klötzli (1972) können die Waldgesellschaften im Sihlwald als typisch bezeichnet werden.
Verbreitete Waldgesellschaften: (siehe auch Tab. 1, Kap. 1.3.4.) Die im schweizerischen Mittelland, so auch im Kanton Zürich und in der Region verbreitet vorkommenden "mittleren" typischen Waldmeister- und Waldhirsen-Buchenwald-Gesellschaften 7a und 8a sind im Sihlwald, allerdings mit umgekehrter Gewichtung, gut vertreten.
Die auf kalkreichem Muttergestein heimischen Gesellschaften des Jura und der Voralpen 9, 11 und 12 sind nur im östlichen Kantonsteil, am Napf und im Jura ähnlich stark bzw. besser vertreten. In der Region sind diese in einer etwa 3 mal geringeren Häufigkeit zu finden.
Die auf nassen Standorten gedeihenden Gesellschaften 26 und 27 sind sowohl im schweizerischen Mittelland als auch im Kanton und in der Region verglichen mit dem Sihlwald etwa halb so häufig vertreten.(Diagramm 1)
Seltene Waldgesellschaften: (siehe auch Tab., Kap. 1.3.4.) Die in der Schweiz selten vorkommenden Waldgesellschaften sind im Sihlwald - mit Ausnahme der Einheiten auf Böden mit wechselnden Wasserverhältnisse - ebenso selten wie im übrigen Mittelland anzutreffen (siehe Tab. 1). Die gesamte Albiskette, namentlich in den Gemeinden Hausen, Stallikon, Zürich, Adliswil, Langnau und Horgen, ist für Mittellandverhältnisse in ausserordentlicher Häufigkeit mit mergeligen und schluffigen Böden ausgestattet. Diese zu Instabilität neigenden Hänge sind deshalb wechselfeucht bis wechselnass, seltener wechseltrocken, und weisen daher eine besondere Artenvielfalt und oft auch eine ungewöhnliche Artenzusammensetzung auf.
Erwähnenswert sind ferner der Tannen-Buchenwald 19 und der Hainsimsen-Buchenwald mit Heidekraut 2 auf dem Albisgrat sowie eine Spur des Schachtelhalm-Tannenmischwaldes 27(49) mit dem eisenhutblättrigen Hahnenfuss unterhalb des Albishorn.
Bemerkenswert gering treten im Sihlwald und in der Region im Vergleich zum Mittelland und zum Kanton Zürich die Gesellschaften saurer Böden 1, 2, 6 und 7d auf. Dies weist auf das kalk- und nährstoffreiche Muttergestein der Linthgletscher-Ablagerungen und der Oberen Süsswassermolasse hin.
Kanton Zürich Region Sihlwald
Einheit Nr. ha % % ha % % ha % %
Trockene, saure Buchenwaldstandorte
1 678,9 1,4 18,7 0,3 2,9 0,3
2 17,6 + 6,4 3,3 0,1 1,4 0,4 + 0,5
6 2'472,7 5,0 54,2 1,0 2,2 0,2
Mittlere Buchenwaldstandorte der Submontanstufe
7* 918,4 1,9 3,7 0,1 - -
7a 6'981,0 14,1 716,0 13,6 72,7 7,3
7aS 1'389,8 2,8 203,7 3,9 55,6 5,5
7d 4'488,7 9,0 43,5 176,7 3,4 41,8 2,1 0,2 18,8
7e 2'270,7 4,6 219,9 4,2 1,7 0,2
7f 4'091,7 8,2 587,5 11,2 36,4 3,6
7g 1'428,7 2,9 283,4 5,4 19,7 2,0
Mittlere Buchenwaldstandorte der unteren Montanstufe
8* 180,4 0,4 30,5 0,6 1,0 0,1
8a 2'064,9 4,2 335,2 6,4 93,2 9,3
8aS 762,2 1,5 90,8 1,7 67,2 6,7
8d 908,5 1,8 15,3 187,3 3,6 19,9 16,7 1,7 31,6
8e 771,7 1,6 42,2 0,8 3,7 0,4
8f 1'953,9 3,9 271,1 5,2 65,8 6,6
8g 938,8 1,9 83,7 1,6 69,4 6,9
Frische und trockene ~alkbuchenwaldstandorte der Submontanstufe
9 1'590,4 3,2 177,8 3,4 7,9 0,8
10 1'195,4 2,4 7,1 69,1 1,3 7,3 0,8 0,1 2,2
lOw 724,2 1,5 134,1 2,6 13,3 1,3
Feuchte Kalkbuchenwaldstandorte der Submontanstufe
11 1'097,9 2,2 2,2 279,3 5,3 5,3 79,3 7,9 7,9
Kalkbuchenwälder der unteren Montanstufe
12a 2'926,9 5,9 131,7 2,5 36,3 3,6
12e 458,4 0,9 18,8 0,4 4,0 0,4
12g 804,0 1,6 10,5 137,6 2,6 8,3 145,9 14,6 21,4
12t 647,4 1,3 56,1 1,0 - -
12w 313,4 0,6 91,9 1,7 28,0 2,8
13 80,8 0,2 3,7 0,1 - -
Wechseltrockene bis wechselfeuchte, basenreiche Buchenwaldstandorte
14 419,8 0,8 28,0 0,5 1,8 0,2
15 448,2 0,9 5,1 25,3 0,5 4,3 3,9 0,4 7,6
16 27,5 0,1 0,1 + - -
17 1'613,1 3,3 171,9 3,3 70,0 7,0
Basenreiche und saure Buchenwaldstandorte der oberen Montanstufe
18 549,7 1,1 21,6 0,4 - -
19 130,9 0,3 1,5 105,6 2,0 2,6 0,5 0,1 0,1
20 61,3 0,1 13,0 0,2 - -
Ahorn- und Lindenwälder
22/22* 19,8 + 2,0 + - -
25/25* 4,2 + - - - -
Ahorn- und Bacheschenwälder
26a 306,5 0,6 34,9 0,6 7,1 0,7
26e 43,4 0,1 13,6 0,1 0,8 0,1
26f 709,5 1,4 61,0 1,1 12,6 1,3
26g 194,6 0,4 3,9 18,3 0,3 4,0 9,6 1,0 8,7
27a 147,4 0,3 32,8 0,6 11,0 1,1
27f 481,6 1,0 61,5 1,2 30,3 3,0
27g 44,9 0,1 4,7 0,1 15,4 1,5
Uebrige Feucht- und Nassstandorte
28 55,7 0,1 3,4 0,1 - -
29 706,8 1,4 152,4 1,0 0,8 0,1
29a 340,1 0,7 - - - -
30 179,5 0,4 137,8 0,7 2,8 0,3
31 0,1 + - - - -
32 0,4 + 0,2 + - -
35a 390,9 0,8 - - - -
35e 150,4 0,3 4,0 - - 3.2 - - 0,6
39 23,6 + - - - -
42* 2,0 + - - - -
43 2,2 + - - - -
44 29,6 0,1 4,6 0,1 0,6 0,1
45 97,2 0,2 45,5 0,9 0,6 0,1
46 7,1 + 1,5 + - -
49 20,1 + 19,4 0,4 - -
Föhrenwälder
61 49,9 0,1 17,6 0,3 2,2 0,2
62 179,5 0,4 0,5 82,1 1,6 1,9 4,3 0,4 0,6
64 7,8 + - - - -
65 0,3 + - - - -
Total 49'603,0 100 100 5'256,8 100 100 1'000,6 100 100
Auf den folgenden Seiten werden die im Sihlwald kartierten Waldgesellschaften kurz beschrieben. Bewusst wird, im Hinblick auf die Zielsetzung des Projektes "Naturlandschaft Sihlwald"/ auf einen waldbaulichen Kommentar verzichtet.
Die ausgeschiedenen Gesellschaften (Assoziationen) sind nach Ellenberg und Klötzli (1972) benannt und numeriert.
Die Untereinheiten (Subassoziationen, diese wiederum unterteilt in Ausbildungen) sind mit Buchstaben ausgezeichnet:
a typische Subassoziation ("Zentrum der Gesellschaft")
b Boden basenarmer und feuchter als bei a
c Boden basenärmer als bei a
d Boden basenärmer und trockener als bei a
e Boden basenreicher und trockener als bei a
f Boden basenreicher als bei a
g Boden basenreicher und feuchter als bei a
w wechselnde Wasserverhältnisse im Boden
.s Ausbildung mit Wald-Ziest (7as, 8as,
feuchte Ausbildungen von 7a und 8a)
* Gesellschaft, die in der Numerierung von Ellenberg
und Klötzli nicht vorkommt. Der * kommt nach
der Nummer der nächstverwandten Gesellschaft.
Lbh Laubholz As Aspe Bah Berg-Ahorn Bi Birke Bu Buche Bul Berg-Ulme Els Elsbeerbaum Es Esche Fah Feld-Ahorn Ful Feld-Ulme Hbu Hagebuche Ki Kirschbaum Mbb Mehlbeerbaum MBi Moor-Birke SAh Spitz Ahorn SEi Stiel-Eiche SEr Schwarz-Erle TEi Trauben-Eiche TKi Traubenkirsche WEr Weiss-Erle WLi Winterlinde Ndh Nadelholz Eib Eibe Fi Fichte Fö Wald-Föhre Ta Tanne
Eindruck: Das typische Waldbild der Einheit mit seinen auffälligsten Merkmalen.
Zusammensetzung:BS Baumschicht (vollständig)
SS Strauchschicht (Pflanzenarten, welche die
Einheit besonders auszeichnen)
KS Krautschicht
MS Moosschicht
Standort: Höhenstufe, Relief, klimatische Bedingungen. Bodenverhältnisse.
Vorkommen: Verbreitung der Einheit (soweit bekannt).
Nahverwandte Ausbildungen oder Einheiten: Ausbildungen, die auf leicht abgeänderte Standortsbedingungen hinweisen, ohne waldbaulich von grosser Bedeutung zu sein.
[Die Beschreibungen finden Sie hier]
Im Zuge der Kartierung der Waldgesellschaften wurden die Waldbestände auf ihre Naturnähe hin überprüft.
Es hat sich gezeigt, den Anteil an "ökologisch problematischen Baumarten" als Massstab für die Beurteilung der Naturnähe bzw. der Naturferne heranzuziehen. Im wesentlichen beschränkt sich daher die durchgeführte Einschätzung auf die Ansprache des Nadelholz-Anteils, wobei den verschiedenen Nadelholzarten je nach "Fremdheit" unterschiedliches Gewicht beigemessen wurde.
Mit der Kartierung der ökologisch problematischen Baumarten lässt sich der "Naturnähe-Grad" des Waldes abschätzen und Problemflächen können mit einem Blick erkannt werden. Die Kartierung basiert auf der Schätzung des Anteils an ökologisch problematischen Baumarten und der Einteilung in folgende drei Kategorien:
Kat. I Bestände mit einem minimalen Anteil an
ökologisch problematischen Baumarten
(Naturnahe Bestände)
Kat. II Bestände mit einem mittleren, im allgemeinen
tragbaren* Anteil an ökologisch
problematischen Baumarten (Naturferne Bestände)
Kat. III Bestände mit einem hohen Anteil an ökologisch
problematischen Baumarten (Naturfremde Bestände)
* In Linden-, Bergahorn- und Erlen-Eschenwäldern sind ökologisch-problematische Baumarten in allen Fällen ökologisch untragbar.
Die Kartierung wird nach folgenden Grenzwerten durchgeführt:
Gesellschaft: Oekologisch problemat. Flächenanteil:
Baumarten:
Kategorie I
1-7, 9-11, 14-17, 26-44 Nadelhölzer ohne Eibe zusammen max. 10%
8, 12, 19 Nadelhölzer ohne Eibe zusammen max. 25%
davon Lärchen+Exoten zusammen max. 10%
61, 62 alle Baumarten zusammen max. 10%
ausser WFö, BFö,
Eibe, Mbb
Kategorie III
Alle Gesellschaften Nadelhölzer zusammen min. 75%
ausser 61, 62
61, 62 Nadelhölzer ohne zusammen min. 75%
WFö, Bfö
Kategorie II
Bereich zwischen den Kategorien I und III.
Bei der Kartierung wurden Bestände in bezug auf ihren Anteil an ökologisch problematischen Baumarten nur angesprochen, sofern sie mindestens 25 Aren gross sind.
Die planmässige Darstellung der naturnahen und naturfremden Bestände bestätigt das subjektive Bild, das ein unbefangener Besucher des Sihlwaldes erhält.
Im allgemeinen sind die optimal nach waldbaulichen Gesichtspunkten gepflegten Waldungen mit standortsheimischen Baumarten bestockt. Die gleichmässige Verteilung der Stämme, deren auffallende Geradschaftigkeit sowie das Fehlen von Totholz und Baumleichen unterscheiden die Waldungen aber eindeutig von solchen mit Urwaldcharakter (vergleiche auch Versuch ETH Birriboden). Auf den Extremstandorten, namentlich den steilen, wechselfeuchten oder nassen Böden zeigen die Bestände, wegen extensiver oder gar ausgebliebener Pflege, urwaldännlichen Charakter.
Nur in den "stadtnahen" Waldabschnitten in Langnau und den angrenzenden Flächen in Horgen, am Sihlzopf sowie auf dem Zimmerberg nehmen standortswidrige Bestände einen namhaften Raum ein.
Im ganzen Kanton Zürich wurde kein zusammenhängendes Gebiet mit ähnlich umfangreicher, naturnaher Bestockung kartiert. Vergleiche mit Jurawäldern wären eher statthaft.
Auffallend ist ferner, im Vergleich zu den übrigen Wäldern im Kanton, der geringe Anteil von Waldflächen, welche der Kategorie II, also den Beständen mit tragbarem Anteil an ökologisch problematischen Baumarten zugeordnet werden können.
Alle grösseren Waldwiesen und die Sihlufer innerhalb des Perimeters wurden kartiert. Es wurde versucht, alle zusätzlichen, kleineren waldfreien Standorte so gesamthaft wie möglich zu erfassen.
Reiche Spezialstandorte wie bemooste Tuffe oder pionierhaft bewachsene Mauern (entlang der Sihltalstrasse), gibt es etliche, wurden hier jedoch nicht berücksichtigt.
Die derart erhobenen Flächen wurden alle im Sommer 1988 abgeschritten, im Mai die landwirtschaftlich genutzten Flachen und im Juli die Sihlufer und übrigen Flächen. Dabei wurde auf die häufigst auftretenden Arten und auf seltene, auffällige Begleitarten geachtet. Aenderte sich die Artenzusammensetzung der einen oder anderen Gruppe deutlich, so wurde diese neue Beobachtung unter einer fortlaufenden Nummer notiert und die Grenzen im Plan festgehalten. Bei der Auswertung erfolgte die Zuordnung aller Beobachtungen zu den als für das Gebiet charakteristisch gewählten Bestandestypen.
Im Plan 3, "waldfreie Standorte" wurden folgende Vegetationseinheiten ausgeschieden:
Aufgrund ihrer Artenvielfalt und der Häufigkeit ihres Vorkommens wurden die 19 Bestandestypen drei ökologischen Werteklassen A, B, C zugeordnet.
Verschiedene Hinweise deuten darauf, dass es im Sihlwald früher mehr Waldfreie Standorte gegeben hat. (Wahrscheinlich wurden auch nicht alle kleineren Waldsümpfe im Plan 3 erfasst):
Es ist zu erwägen, ob im Hinblick auf die biologische und landschaftliche Vielfalt wieder vermehrt offene Bereiche geschaffen werden sollen. Dies betrifft vor allem feuchte Gebiete (Waldgesellschaften 27, 30, 44). Im Besonderen gilt es für das Langenmoos (Nr. 85.36), wo sehr seltene Bruchwälder mit Hochmoorvegetation gehegt werden müssen. Offene oder locker bestockte Zonen, die Uebergänge zu waldfreien Flachen bilden, sind von Natur aus auf wechseltrockenen Standorten vermehrt noch vorhanden: Waldgesellschaften 10w, 12w, 14w, 15w, 17, 61, 62.
Ca. 100 km Waldränder gliedern oder grenzen die Naturlandschaft Sihlwald ein.
Dass den Waldrändern eine spezielle Bedeutung zukommt, ist erst in den letzten Jahren (wieder) etwas in den Vordergrund gerückt. Allzu häufig findet man aber noch die abrupten Uebergänge vom Freiland zum Wald. Der Wald wird bis zum Saum, quasi bis zum äussersten Baum auf der Grenze genutzt, während vom Freiland her Aecker, Wiesen und Weiden oder Strassen, Parkflächen und Gärten bis an die Waldgrenze reichen.
Unter diesen Umständen bleibt kein Raum für die Ausbildung eines Waldsaumes mit einer Strauchzone, wie sie entlang natürlicher Waldgrenzen (z.B. zu Mooren und Seen) auftritt oder wie wir sie von den verwandten Hecken her kennen.
Die Erforschung der Lebensräume von Vögeln, Insekten, Reptilien, Amphibien, aber auch von Wildpflanzen zeigt immer deutlicher, dass ökologisch richtig gepflegte Waldränder eine wichtige Stellung für die Arterhaltung vieler Tiere und Pflanzen einnehmen.
Abb. 2: Querschnitt durch einen ökologisch wertvollen Waldrand
Die Feldarbeit wurde in 2 Teilen im März 1987 und im Juni 1988 durchgeführt. Dabei wurden sämtliche Waldränder mit Plan und Kartierungsschlüssel abgeschritten. Der verwendete Schlüssel (siehe Kap. 4.2.) ist vierteilig aufgebaut und beschreibt einen Querschnitt durch den jeweiligen Waldrandabschnitt.
Abb. 3: Querschnitt durch einen Waldrandabschnitt
So konnten die wichtigsten, augenfälligen und ökologisch wesentlichen Kriterien erfasst werden.
Die differenzierte Beschreibung (siehe Seite 29 bis 31) der einzelnen Waldrandabschnitte wurde nach ökologischen Kriterien gewertet und in vier Kategorien eingeteilt:
A ökologisch wertvolle Waldränder B ökologisch mittlere Waldränder C ökologisch mittel-arme Waldränder D ökologisch sehr arme Waldränder
Zusätzlich sind angrenzende Naturschutzgebiete, die eine spezielle Waldrandpflege erfordern, mit dem Index N ---- und schwere Hindernisse, wie Hauptstrassen, hohe Mauern oder Maschenzäune mit dem Index X bezeichnet.
Die Sihl ist als angrenzendes Biotop und Hindernis nicht speziell bezeichnet.
Der Schlüssel zur Waldrandkartierung ist im Winter 1986/87 erstellt und im Sihlwald erstmals angewendet worden.
Gewisse Waldrandeigenschaften können ökologisch verschiedene, ja widersprüchliche Wertungen erfahren, je nachdem welche Tierart oder Pflanze man gerade fördern will.
In diesem Sinn ist der Schlüssel noch nicht ausgefeilt. Fachgespräche mit Ornithologen, Amphibien-, Reptilien- und Insektenkundigen können noch Verschiebungen oder Differenzierungen ergeben.
Die Darstellung der Waldränder nach den 4 Kategorien ergeben ein erstaunlich farbiges Bild. Obwohl kleinste Abschnitte unter 50 Meter auf dem Plan nicht ausdifferenziert wurden, tritt der kleinmassstäbliche Wechsel der Waldrandqualitäten hervor. Dies ist ein Ausdruck einer kleinräumigen Bewirtschaftung des Waldes und des angrenzenden Freilands.
Oekologisch wertvolle Waldränder sind meistens auf schlecht nutzbaren Böden anzutreffen, wo dank extensiver Bewirtschaftung der Uebergang Feld/Wald fliessend wird.
Die häufigen mittleren Waldränder finden sich unter fast allen Bedingungen und sind ein Resultat der Waldbewirtschaftung.
Die Entstehung ökologisch armen bis sehr armen Waldränder können auf zwei hauptsächliche Ursachen zurückgeführt werden:
Auf forstlicher Seite führen vor allem standortsfremde Baumarten (Nadelholzpflanzungen jeden Alters) und die intensive Baumnutzung bis an die Grenzen des Waldes zu schwach ausgebildeten Waldrändern. Ebenso häufig verursacht aber die intensive Bewirtschaftung der angrenzenden Felder nackte Waldränder. So sind Weidezäune oft an den Bäumen befestigt oder werden im Wald gezogen und verhindern so das Aufkommen einer Strauchzone. Acker und Mähwiesen grenzen meist auch direkt an die Waldränder, ohne einen genügenden Brachstreifen mit Feldgehölzen zu ermöglichen.
Ohne die einzelnen Kategorien genau ausgemessen zu haben, ergibt sich schätzungsweise folgende Verteilung im Sihlwald:
A B C+D
% % %
Rechts der Sihl 20 65 15
Links der Sihl 10 50 40 (z.Teil ausserhalb des Perimeters)
Innere Waldränder 40 40 20
Eine genaue Auswertung hätte auch die speziellen Verhältnisse entlang der Sihl, der Bahn und vor allem längs der Sihltalstrasse zu berücksichtigen.
ART DES WALDRANDES A1 - Laubwaldrand mit 50-100% Unterholz B1 - Mischwaldrand mit 50-100 Unterholz C1 - Nadelwaldrand mit 50-100% Unterholz D1 - Stangennadelholzwaldrand m. 50-100% Unterh. A2 - Laubwaldjungholz B2 - Mischwaldjungholz C2 - Nadelwaldjungholz A3 - Laubwalddickung B3 - Mischwalddickung C3 - Nadelwalddickung A4 - Laubwaldrand 'ohne' Unterholz (0-50%) B4 - Mischwaldrand 'ohne' Unterholz (0-50%) C4 - Nadelwaldrand 'ohne' Unterholz (0-5%) D4 - Stangennadelholzwaldrand ohne Unterholz E - Angehängte Feldgehölze Spez. : s. Bemerkungen TIEFE DES WALDRANDES ( nur für A1 , B1 , C1 , D1 ) a - 0m b - 0-5m c - 5-l5m d - über 1 5m HINDERNISSE 0 - Kein Hindernis 1 - Graben 2 - Feldweg, Waldweg, Zufahrt 3 - Mauer (länger als 50m) 4 - Bach (breiter als 1m) 5 - Strasse mit Durchgangsverkehr 6 - Maschenzaun FREILAND (äusserer Waldrand) 11 - Biotop (Feuchtgebiet, Trockenrasen) 12 - Magere Wiese oder Weide 13 - Fette Wiese oder Weide 14 - Acker 15 - Garten (Schrebergarten) 16 - Bebaute Fläche (Siedlung) FREILAND (innerer Waldrand) 21 - Biotop 22 - Magere Wiese oder Weide 23 - Fette Wiese oder Weide 24 - Acker 25 - Garten 26 - Bebaute Fläche SAUM (innerer Waldrand) 31 - Kahlschlag, Windwurf 32 - Jungwuchs. Kü, BGU 1987/2
ZUORDNUNG DER ZAHLEN- UND BUCHSTABENKOMBINATIONEN
PROJEKT SIHLWALD WALDRANDKARTIERUNG
______________________________________________________
Sektor Plannummer Datum Kartierer/in
______________________________________________________
Abschnitt-NR | WR-Typ | Bemerkungen
________________|______________|______________________
| |
| |
| |
BGU 1987
Die Einmaligkeit des Sihlwaldes wird gewichtet durch seine Zugehörigkeit zum BLN-Objekt Albiskette-Reppischtal. Seine grosse Ausdehnung verleiht ihm etwas ganz besonderes, das die gewohnten Mittelland-Dimensionen sprengt (siehe im Plan 5: Aussichtspunkte). Dieser Wald birgt vielerlei Entdeckungen, überrascht mit schönen Waldbildern. Solche liessen wir bei der folgenden Arbeit wirken (Psychotope, Plan 5: "Bestände mit erhöhter Strukturvielfalt".)
Aus ökologisch-geomorphologischer Sicht wurde der Sihlwald in 26 Gebiete gegliedert, die von besonderen Eigenschaften geprägt sind. Abgegrenzt wurden wenn möglich gesamte Landschaftskammern, z.8. gesamter Bachlauf in Gebiet 12. Die Grenzen der Gebiete sollten gut nachvollziehbar sein, etwa bereits bestehende Grenzen anlehnen (Abteilung, Topographie, Waldgesellschaft). Aus arbeitstechnischen Gründen wählten wir auch die Grenze des Sihlwald-Perimeters.
Als Entscheidungsgrundlage für die Charakterisierung standen folgende Informationsquellen zur Verfügung:
Die uns bekannten Informationen wurden pro Gebiet auf einem Blatt zusammengestellt.
Die leicht nach Nordosten geneigten, mit reichen, wüchsigen Buchenwäldern bestockten Waldterrassen (Böden, oft mit Bärlauch) dominieren den Sihlwald über weite Strecken. Sie wurden nicht als Gebiete ("Psychotope") ausgeschieden. Doch auch diese Waldpartien bieten Besonderheiten (z.B. Versuchsflächen Birriboden).
Die erhöhte Strukturvielfalt jedoch kommt zum Ausdruck,
Diese beiden besonderen Gebietstypen sind trittempfindlich, die nassen, flacheren in höherem Masse als die steilen, wechselfeuchten. Letztere sind ein Mosaik von verschiedenartigen Sukzessionsfolgen auf Pionierstandorten. Beide müssten geschont werden.
Zur Schilderung der heutigen Vegetation und Strukturvielfalt samt ihrem Potential im Sihlwald wurden 5 gleich betitelte Pläne wie Kap. 1-5 ausgearbeitet und beschrieben. Details wurden nur zurückhaltend in diese Arbeit aufgenommen. Verknüpfende Gedanken zwischen den Themen sind nur ansatzweise festgehalten worden. Themenübergreifende Auswertungen und Ueberlegungen dazu sowie das Bedenken von Massnahmen gehören in eine nächste Arbeitsphase.
Etwas vom eindrücklichsten im Sihlwald ist nebst seiner räumlichen, seine zeitliche Dimension. Die Extremstandorte können als von der Natur geschaffene Museen betrachtet werden. Je nach Alter der Rutsche kann der Beobachter in verschieden weit zurückliegende Zeiträume schauen. Das schönste Beispiel für solche Betrachtungen ist das Brunnentobel, wo verschieden alte resp. bewachsene Rutsche auf kleinem Raum anschaulich beieinander liegen. In Anbetracht der Diskussion um den Sihlwald als Erholungsraum sei darauf hingewiesen, dass solche Räume zu schonen sind (trittempfindlich). Dies gilt auch für alle feuchten Standorte.
Die Wälder im Sihlwald sind mit Ausnahme der Reservate und den stufigen Beständen nach herkömmlichen waldbaulichen Gesichtspunkten eingerichtet. Der WP 81 zeigt auf, dass diese Waldungen nicht nachhaltig angebaut sind. Die mittelalten Bestände sind in starkem Masse übervertreten, während es an jüngeren Beständen und leider auch an Altholzbeständen mangelt.
Die im WP 81 geforderte, nachhaltige Verjüngungsfläche hatte zur Folge, dass wesentliche Teile der damals noch vorhandenen Altholzbestände verschwunden sind und, falls weiter hin nach jenen Vorgaben gehandelt wird, der Rest der alten Hölzer auch noch verschwinden wird. Im Hinblick auf die Ziele des Projektes Naturlandschaft Sihlwald sollten die Altholzbestände, namentlich die laubholzreichen, nicht mehr wie bisher nach ertragskundlichen Ueberlegungen geerntet werden. Statt dessen sind die standortsfernen und -fremden Baumholzbestände trotz allfälligen wirtschaftlichen Einbussen vorzeitig zu verjüngen.
Mit der WP-Revision von 1991 sind, falls das Projekt NLS zeitlich verzögert zustande kommen sollte, weitere Gebiete als Reservate auszuscheiden. Die Umtriebszeiten sind nach Standortsklassen zu differenzieren und zu erhöhen. Die standortswidrigen Bestände sind umzuwandeln oder in stufige Bestände zu überführen.
Die Massnahmen zur Erreichung des Zieles, in Stadtnähe ein grossflächig zusammenhängendes Waldareal mit urwaldähnlichen Strukturen zu erschaffen, kann, unter Voraussetzung der Opferbereitschaft des Waldeigentümers, also der Stadt Zürich, heute schon weitgehend eingeleitet werden.
Voraussetzung dazu ist ein, auf allen Stufen der beteiligten forstlichen Instanzen tiefgreifendes Verständnis für die natürlichen Vorgange unter den vielfältigen Lebensbedingungen im Sihlwald.
Wir sind überzeugt, dass die vorliegende Arbeit zum Erreichen des angestrebten Zieles in verschiedenen Belangen ein wertvolles Hilfsmittel sein kann.
Egloff F., 1977: Wasserpflanzen des Kantons Zürich. Vierteljahresschrift der Natur für Ges. in Zürich, Jg. 122, Heft l.
Ellenberg H. und Klötzli F., 1972: Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz. Mitteilungen EAFV Bd. 48, Heft 4.
Blätter der Vereinigung Pro Sihltal Nr. 9 (1959), Nr. 15 (1965), Nr. 28 (1978), Nr. 36 (1986).
Bosshard, W. (Hrsg.), 1981: Physikalische Eigenschaften von Böden der Schweiz. Lokalformen 2. EAFV, Birmensdorf.
Inventare
Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte des Kantons Zürich, 1978 + 1979 Gemeinde Horgen, Langnau a.A., Hirzel, Oberrieden, Hausen a.A.
Natur- und Landschaftsschutzobjekte von kommunaler Bedeutung der Gemeinde Horgen. 1988.
Ornithologisches Inventar des Kantons Zürich: Bestandesaufnahmen ornithologisch wertvoller Waldflächen. 1981. Zürcher Kantonalverband für Vogelschutz.
Irniger M., 1988: Kulturhistorische Monumente, Zwischenbericht Naturlandschaft Sihlwald.
Kanton Zürich: Oberforstamt, Amt für Raumplanung (Hrsg.), 1988: Kommentar zur Vegetationskundlichen Kartierung der Wälder im Kanton Zürich. Forstkreis I.
Krebs, E., o.J.: Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette. Kommissionsverlag der Genossenschafts-Buchhandlung Winterthur.
Luftbilder Sihlwald vom 24.4.1980: Stadtforstamt der Stadt Zürich.
Schwarze M. und Hünerwadel D., 1987: Massnahmen zur Erhaltung und Förderung von naturnahen Waldrandbereichen auf dem Gebiet der Stadt Zürich. Stadtforstamt Zürich - Bauamt I.
Wirtschaftsplan über den Waldbezirk Sihlwald: 1971 und 1981.