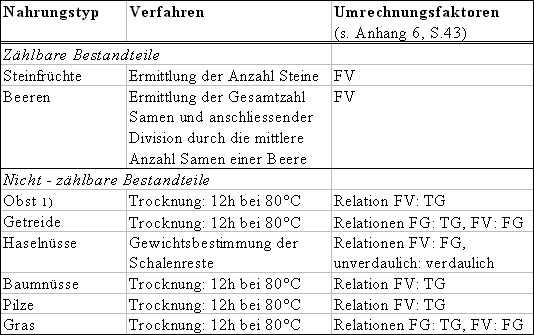2 METHODEN
2.1 Untersuchungsgebiet
Der Sihlwald liegt rund 10 Kilometer südlich des
Stadtzentrums von Zürich zwischen der Albis- und der Zimmerbergkette. Er
umfasst rund 10 km² und gilt als grösster zusammenhängender
Laubmischwald des Schweizerischen Mittellandes. Begrenzt wird der Sihlwald im
Norden und Osten durch Siedlungsgebiet (Langnau und linkes Zürichseeufer),
im Westen und Süden durch unterschiedlich intensiv genutztes
Landwirtschaftsgebiet (Knonaueramt und Zugerland). Der grösste Teil dieser
Fläche ist sehr naturnah bestockt und dank der Stiftung Naturlandschaft
Sihlwald
[1] wird der Wald seit 1994 grossenteils
nicht mehr bewirtschaftet. Der Wald an der Sihl ist vorwiegend kleinräumig
gegliedert. Abwechslungs- und Strukturreichtum bieten viele Lebensräume
für Fauna und Flora: Auf den rund 1000 Hektaren des Sihlwaldes wurden 54
der 67 im ganzen Kanton vorkommenden Waldgesellschaften gefunden (HUEHNERWADEL
et al. 1993).
2.1.1 Geologie, Boden, Vegetation
In den terrassenartigen oder mässig steilen Zonen haben
sich aus den Verwitterungsprodukten der oberen Süsswassermolasse
tiefgründige, frische bis feuchte, lehmig-tonige und mineralreiche
Braunerdeböden entwickelt, die sich durch ausserordentliche Fruchtbarkeit
auszeichnen. Hier stehen gut wüchsige Buchen- oder bei zunehmender
Bodenfeuchte, Eschenwälder. An den Steilhanglagen des Albisgrates sowie den
Erosionsfächern der Bäche ist die Bodenbildung jedoch nach wie vor
gering, die Böden sind allgemein flachgründig und die Wuchsbedingungen
für die Pflanzen sind suboptimal. Hier stockt ein Mosaik von Buchen-,
Eiben- und Föhrenbeständen sowie beigemischten Weisstannen, Eschen und
Bergahornen, wie es für unstabile Böden typisch ist. Kleinflächig
bestehen jedoch bedeutende Unterschiede (GUGGELMANN & LICHTI 1962, zitiert
in HUEHNERWADEL et al. 1993).
2.1.2 Klima
Mit der tiefsten Lage von ca. 470 m.ü.M. an der Sihl bei
Langnau und der höchsten auf der Bürglen 914 m.ü.M., befindet
sich der Sihlwald in der Uebergangszone von der submontanen zur unteren montanen
Klimazone (HUEHNERWADEL et al. 1993). Im Vergleich zur Stadt Zürich sind
die Niederschlagsmengen im Sihlwald höher: Neben der Nordostexposition
grosser Teile des Sihlwaldes trägt die Nähe der niederschlagsreichen
Voralpen zu diesem Effekt bei. Meteorologische Daten aus dem Sihlwald selbst
sind keine vorhanden. Die nächstgelegene Messstation, die von der
Schweizerischen Meteorologischen Anstalt berücksichtigt wird, ist
Wädenswil. Wegen der speziellen Lage des Sihlwaldes sind die
verfügbaren Daten aber nur mit Vorsicht zu interpolieren.
Kotanalyse
2.2.1 Grundlagen
Grundlage für die Untersuchung des Nahrungsspektrums des
Dachses war die Kotanalyse. Dachse setzen ihren Kot in selbstgegrabenen Gruben,
sogenannten Latrinen, ab, die nicht zugescharrt werden. Die Kotstellen liegen
über das ganze Gebiet des Sihlwaldes verteilt (s. Anhang 9,
S.46).
Die insgesamt 88 untersuchten Kote stammen aus 41 Latrinen und
wurden monatlich (ausser Dezember, Februar und September) von Karin Hindenlang
gesammelt. Aus derselben Latrine lagen maximal 3 Proben vor, diese jedoch aus
verschiedenen Kotgruben. Pro Monat wurden zwischen 2 (November) und 16 Kote
(Mai) untersucht. Die geringe Anzahl vorliegender Kotproben in den Wintermonaten
ist auf die reduzierte Stoffwechseltätigkeit der Dachse während der
Winterruhe zurückzuführen. Die Sammlung der Proben konnte nur bei
trockenen Witterungsverhältnissen durchgeführt werden, da sonst eine
klare Trennung der einzelnen Kote von der umgebenden Streuauflage, aber auch von
älteren, tieferliegenden Koten nicht mehr möglich war. Die Kote wurden
bis zur Analyse in Plastikbeuteln im Tiefkühler aufbewahrt. Im Labor wurde
das Material von Isabelle Minder (Diplomandin der Uni Zürich, Wildforschung
& Naturschutzökologie) aufgetaut, das Volumen bestimmt, in Wasser
aufgeschlämmt und durch ein 1,3 mm-Sieb, sowie ein 0,5 mm-Sieb (um
Regenwurm-Borsten zu erfassen) gewaschen. Der Rückstand vom 1,3 mm-Sieb
wurde dann in tierische und pflanzliche Komponenten aufgetrennt. In dieser
Arbeit werden nur die pflanzlichen Nahrungstypen behandelt.
2.2.2 Sortieren und Bestimmen der ausgewaschenen Reste
Die pflanzlichen Nahrungsreste wurden unter dem Binokular
(6,4- 25fache Vergrösserung) mit Hilfe von Bestimmungsliteratur,
Vergleichssammlungen sowie unter Beizug von Spezialisten bestimmt und in
Kategorien zusammengefasst.
Tabelle 1: Erkennungsmerkmale der einzelnen
Nahrungstypen
|
Nahrungstyp
|
Erkennungsmerkmal
|
Referenz
|
|
Steinfrüchte
|
Steine
|
|
|
|
- Kerne / Fruchtfleisch bzw. Samen
|
- • Referenzsammlung WSL
- Geobot. Inst. der ETH Zürich
|
|
|
- Aussenhaut des Korns (Mais), Körner (Weizen)
|
- • Referenzsammlung Geobot. Inst. ETH
Zürich
|
|
|
|
|
|
|
- Peridie (Aussenwand), Sporen
|
- • Bestimmung durch Prof. Dr. Horak vom
Geobot. Inst. der ETH Zürich
|
|
Kraut- und Holzpflanzensamen
|
Samen
|
- Referenzsammlung des Geobot. Inst. der ETH
Zürich
- Literatur: SCHOCH et
al. (1988), BERGGREN (1969), BERGGREN (1981), ANDERBERG (1994)
|
|
|
|
|
|
|
- Steinchen, kleine Aeste, Kräuter, Laub, Feinwurzeln, Rindenstücke,
sowie Kraut- und Holzpflanzensamen
|
-
|
2.2.3 Quantifizierung
Für die Quantifizierung der einzelnen Beutetypen wurden
die unverdauten Reste jeder Nahrungskategorie in der Kotprobe auf das
durchschnittliche, aufgenommene Frischvolumen umgerechnet (s. Tabelle 2).
Für kleine, in ihrer Gesamtheit gefressene Nahrungsbestandteile war dieses
Verfahren einfach. Bei nicht zählbaren Nahrungstypen wurde das
Frischvolumen über das Trockengewicht der unverdaubaren Bestandteile
bestimmt:
Tabelle 2: Quantifizierungsverfahren der
einzelnen Nahrungstypen
Frischvolumen (FV), Frischgewicht (FG), Trockengewicht
(TG)
1) Annahme (da nicht immer Kerne vorhanden waren): Bei der
grössten gefundenen Menge handelte es sich um eine ganze gefressene Frucht.
Alle anderen Vorkommen von Obst wurden anhand dieser Referenz berechnet.
Das Volumen des Humus wurde nicht bestimmt, da diese
Bestandteile wohl nebenbei beim Erbeuten anderer Nahrungstypen passiv
aufgenommen wurden bzw. beim Kotsammeln in die Proben gelangt waren.
Die Darstellung der Kotanalyse-Ergebnisse erfolgte auf
zwei Wegen. Zum einen wurde der Präsenzindex (Frequenz) jeder
Nahrungskomponente in der Gesamtprobe nach folgender Formel berechnet:
Präsenzindex = Anzahl der Proben mit einer
bestimmten Beute x 100 / Gesamtzahl der Proben
Diese Form der Darstellung erlaubt es jedoch nur, Aussagen
über das Vorhandensein bestimmter Beuten zu treffen. Daher erfolgte die
Auswertung zum anderen über den Abundanzindex (Volumenprozente), der
die Volumenanteile der einzelnen Beutekategorien angibt:
Abundanzindex = Volumen einer bestimmten Beute x 100 /
Σ Volumen aller Beute- typen pro Kot
2.2.4 Fütterungsversuche im Tierpark Goldau
Um Anhaltspunkte über die Verdaubarkeit von Nüssen
und Pilzen zu erhalten, wurde ein Fütterungsexperiment mit zwei in einem
Gehege lebenden Dachsen im Tierpark Goldau durchgeführt. Am 20. Oktober 97
erhielten die beiden Tiere neben der halben Portion alltäglichen Futters,
81 Regenwürmer, 11 Baumnüsse, 32 Haselnüsse und 9 Champignons in
einem zusätzlichen Futtergeschirr angeboten. An sechs darauffolgenden
Tagen, an denen die Dachse wieder das gewohnte Futter bekamen, wurden alle
Kotproben auf Reste der zugefütterten Nahrungs-typen hin untersucht.
2.3
Untersuchung
des
Nahrungsangebots
2.3.1 Grundlagen
Die Angebotsbestimmung erfolgte bei denjenigen pflanzlichen
Nahrungstypen, die nach Literaturangaben von Dachsen genutzt werden und
gleichzeitig im Habitat ‘Wald’ vorkommen (HENRY 1984, HOFER 1990,
KISTLER & MISTELI 1984, MOUCHES 1981). Da das Untersuchungsgebiet viel zu
gross war, um in der zur Verfügung stehenden Zeit flächendeckende
Analysen durchzuführen, fand eine Beschränkung auf folgende Bestandes-
bzw. Strukturtypen statt:
- Laubwald
- Laubmischwald
- Nadelwald
- Waldrand
- Lichtungen
Waldesinnere
Als Waldesinneres werden im Folgenden die drei
Waldbestände Laub-, Laubmisch- und Fichtenwald bezeichnet. Die Auswahl der
Waldbestände erfolgte anhand einer Bestandeskarte von 1982 (HUEHNERWADEL et
al. 1993) im Massstab 1:10’000, welche Alter, Mischungsverhältnis und
Hauptbaumart der Bestände angibt (s. Anhang 10, S.47).
- Alterskategorie:
Da rund zwei Drittel der
Bestände von Laubholz dominiert sind und zugleich das ‘mittlere Baum-
und Altholz I’ (60-100 Jahre) zusammen mehr als die Hälfte des
Sihlwaldes umfasst (z.T. eine Folge der Schneebruchkatastrophe von 1885), wurden
diese Altersstufen für die Untersuchung des Laub- und Laubmischwaldes
ausgewählt. Bei den Nadelholzbeständen wurde das Stangenholz (20-40
Jahre) untersucht. Die grosse Häufigkeit dieser Altersklasse fällt mit
dem waldbaulichen und betriebswirtschaftlichen Neubeginn der Waldbewirtschaftung
vor rund 40 Jahren zusammen (HUEHNERWADEL et al.
1993). - Mischungsgrad:
Für Laub- und
Laubmischbestände wird ein Nadelholzanteil von 0-10% bzw. von 10-50%
angegeben. Bei den ausgewählten Fichtenbeständen beträgt der
Nadelholzanteil über 90%. - Hauptbaumart:
Bei den Laub- und Laubmischbeständen ist die Buche die häufigste
Baumart, bei den Nadelwaldbeständen die Fichte.
Waldrand
Als Waldrand wurde in dieser Untersuchung ein 3-5 Meter
breiter Uebergangsbereich (je nach Aufnahmemethode) von Wald zu Landwirtschafts-
bzw. Siedlungsfläche bezeichnet. Der Uebergangsbereich zur Sihltalstrasse
galt somit nicht als Waldrand.
Lichtungsrand
Die Lichtungsränder wurden als innere Waldränder
behandelt. Die Auswahl der Lichtungsränder erfolgte aufgrund des
Waldgestaltungsplanes des Sihlwaldes (HUEHNERWADEL et al. 1993), wobei nur
Ränder von Lichtungen, die grösser als 1 Hektare waren, in die
Untersuchung eingingen.
2.3.2 Kirschen (Prunus avium)
Kartierung der Kirschbäume
Zum Blühzeitpunkt der Kirschbäume (April) wurden
diese flächendeckend in den ausgewählten Beständen aufgenommen
und in der Bestandeskarte (s. Anhang 11, S.48) eingezeichnet (Genauigkeit:
±2 mm = ±10 m im Gelände). Zusätzlich wurde noch der
Brusthöhendurchmesser (1,60 m ab Boden, Genauigkeit: ±1 cm) notiert.
Da zu diesem Zeitpunkt das Blätterdach der Laubbäume noch nicht voll
entwickelt war, konnten die Kirschbäume aus relativ gros-ser Distanz
erkannt werden. Die Kartierung erfolgte über drei Wochen verteilt, da die
individuellen Blühzeitpunkte, sowie die Höhenlage (der Sihlwald
erstreckt sich von 464-914 m.ü.M.) zur Erfassung des gesamten Angebots
berücksichtigt werden mussten.
Angebotsbestimmung
Zur Reifezeit (Stichtage: 7./8. Juli) der Früchte wurden
diejenigen Bäume (n=18) auf ihr Kirschenangebot hin untersucht, deren
Brusthöhendurchmesser am nächsten beim Mittelwert aller Bäume lag
und die auf mehr oder weniger ebener Lage stockten (bei Bäumen an
Steilhängen rollen die Kirschen hangabwärts). Da das Angebot an
Kirschen auf dem Boden erstaunlich gering war, wurden alle auf dem Boden
liegenden Kirschen gezählt (Umkreis je nach Baumgrösse). Die
angefressenen Früchte wurden separat aufgenommen und gingen als halbe
Früchte in die Angebotsbestimmung ein. Das Gesamtangebot an Kirschen (s.
Anhang 8, S.45) wurde durch Multiplikation der ausgezählten Kirschen der
Stichprobenbäume mit der Anzahl gefundener Kirschbäume
ermittelt.
Angebotsdauer
Die Angebotsdauer der untersuchten Nahrungstypen wurde nur
qualitativ (Beobachtung) angegeben. Da in dieser Arbeit das Angebot des Jahres
1997 mit der Nutzung des Jahres 1996 verglichen wird, war eine quantitative
Angabe der Angebotsdauer nicht sinnvoll.
2.3.3 Brombeeren (Rubus fruticosus)
Mangels geeigneter Luftbilder vom Sihlwald, musste das
Brombeerangebot mit Hilfe von Stichproben bestimmt werden.
Stichproben
In den ausgewählten Bestandestypen wurde auf der
Bestandeskarte (HUEHNERWADEL et al. 1993) ein Stichprobennetz eingezeichet. Da
die Brombeeren im ganzen Gebiet des Sihlwaldes vorkommen und keine
regelmässige Verteilung erwartet wurde, fand die systematische
Stichprobennahme Verwendung. Das Stichprobennetz wurde in den einzelnen
Beständen soweit verdichtet, dass jeder Bestandestyp mit je 30
Stichprobenflächen vertreten war (s. Anhang 11, S.48). Um einen
Anhaltspunkt über die erforderliche Anzahl Stichproben zu erhalten, wurde
das Stichprobennetz in einigen Mischwaldbeständen (Nr. 2203, 2402, 3013 und
3111) auf die doppelte Anzahl verdichtet (n=14). Auf den Lichtungen bzw. am
Waldrand wurden die Stichprobenpunkte im Abstand von 50m bzw. 100m (im
Gelände) angeordnet (45 bzw. 34 Stichprobenflächen).
Im Gelände wurden die Stichprobenpunkte aufgesucht und
allenfalls in nördlicher Richtung verschoben (Ausschlusskriterien: Wege,
Feuerstellen, Hütten, Rutschungen, Felsen und Bäche). Auf einer
Fläche von 200m² (im Waldinnern) bzw. 50m² (Waldrand/Lichtungen)
wurde der Deckungsgrad in Anlehnung an BRAUN-BLANQUET (1964)
geschätzt.
Angebotsbestimmung
Zur Reifezeit (Stichtage: 25./27. Aug. und 2. Sept.) wurde das
Beerenangebot auf zufällig ausgewählten, 3x3 Meter grossen
Flächen (Deckungsgrad betrug 100%) gezählt (n=21) und anschliessend
linear auf die gesamten Bestände hochgerechnet (s. Anhang 8,
S.45).
2.3.4 Haselnüsse (Corylus avellana)
Es wurden dieselben Stichprobenflächen und Methoden wie
bei der Angebotsbestimmung der Brombeeren verwendet.
Angebotsbestimmung
Zur Reifezeit (Stichtag: 3. Okt.) wurden die am Boden
liegenden bzw. die sich bis maximal 1 Meter über Boden befindlichen
(nach NEAL 1977 klettern Dachse nur selten und ungeschickt), nicht von Parasiten
befallenen Nüsse von 20 Sträuchern gezählt. Anschliessend wurde
das Gesamtangebot analog wie bei den Brombeeren ermittelt.
2.3.5 Hypogäische (unterirdische) Pilze
Quantitative Methode
In den ausgewählten Bestandestypen (s. S.10) wurden die
Stichprobenflächen nach der Mächtigkeit der Humusschicht
ausgewählt, da die hypogäischen Pilze ihre Fruchtkörper zwischen
dem meist relativ kompakten Mineralerdehorizont und der lockeren Humusschicht
ausbilden (FOGEL 1976). Auf den Stichprobenflächen wurde ein systematisches
Stichprobennetz angelegt (Maschenweite: 2 m). Auf Flächen von 1 m²
wurde die Streuschicht entfernt und ca. 5-10 cm tief in den
Mineralerdehorizont gegraben.
Qualitative Methode
In zufällig ausgewählten Beständen wurde nach
Tierspuren (in erster Linie von Mäusen und Eichhörnchen) gesucht
(CLARIDGE & MAY 1994, PIROZYNSKI & MALLOCH 1988, BERGSTORM 1979). Oft
werden von den Kleinsäugern nicht die ganzen bzw. nicht alle Pilze
ausgegraben, sodass eine grosse Wahrscheinlichkeit besteht, die patchweise
vorkommenden Fruchtkörper dort zu finden (S. EGLI, mündl.).
[1]Zusammenschluss von Pro
Natura Schweiz, Pro Natura Zürich, Stadt Zürich, Schweizerische
Akademie der Naturwissenschaften und Naturforschende Gesellschaft in
Zürich.