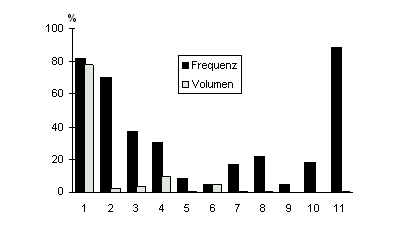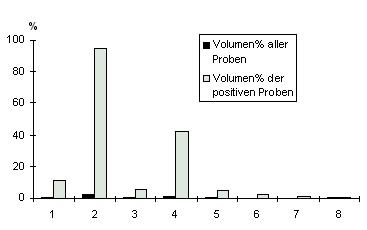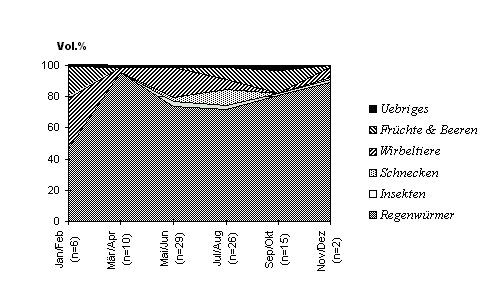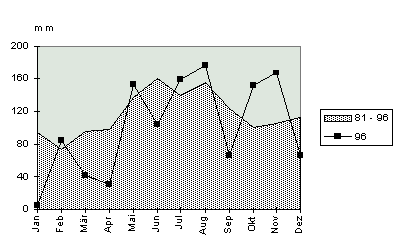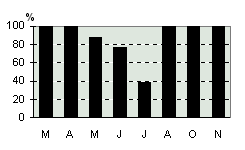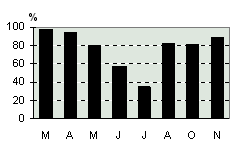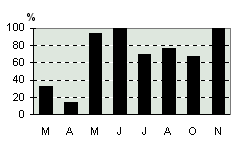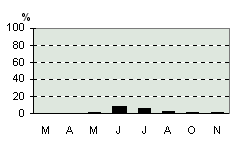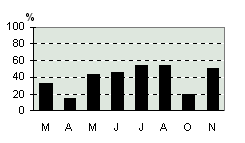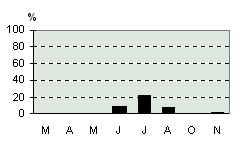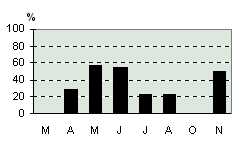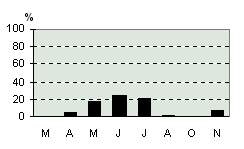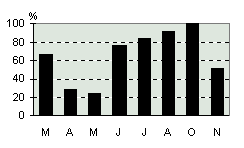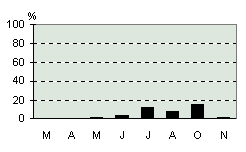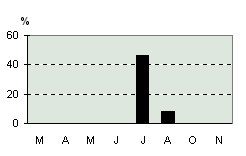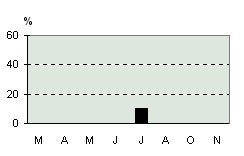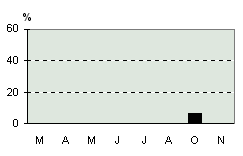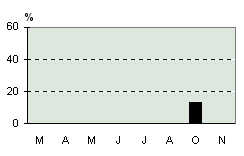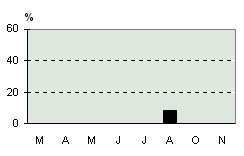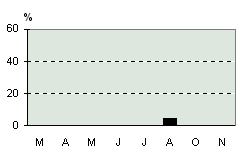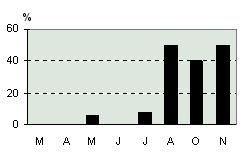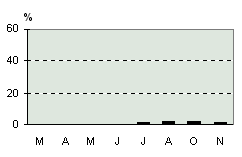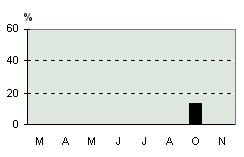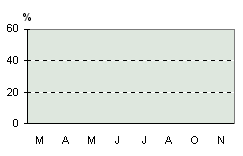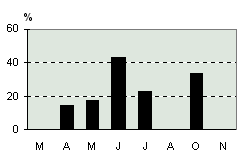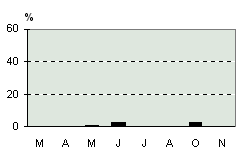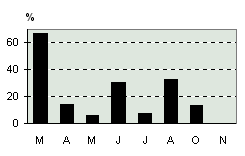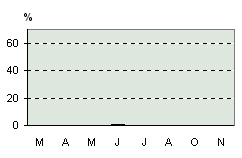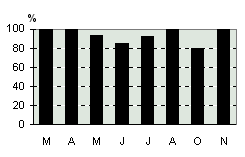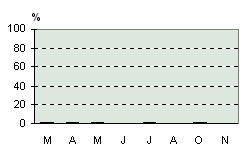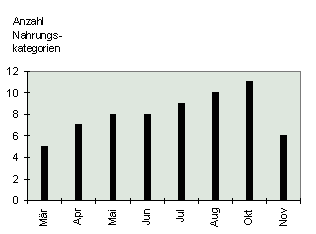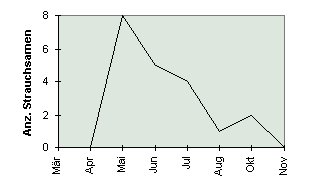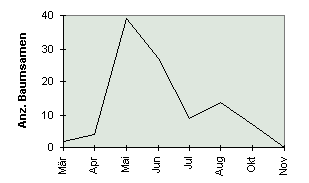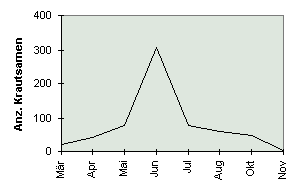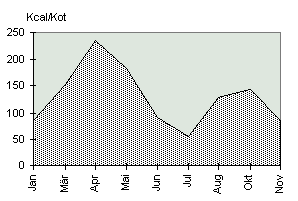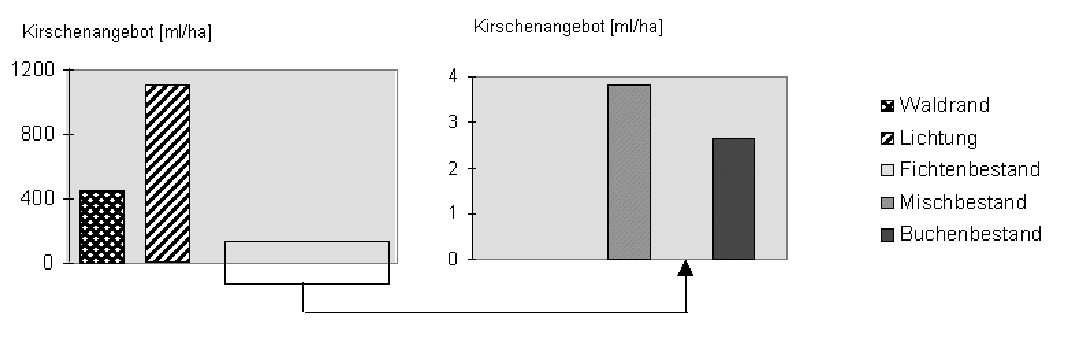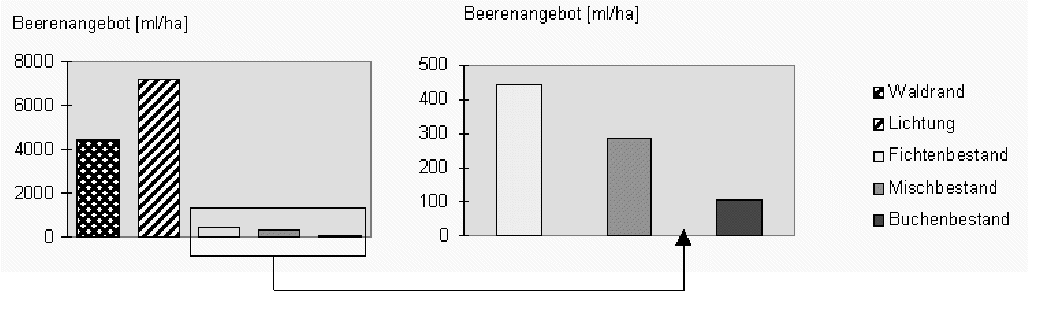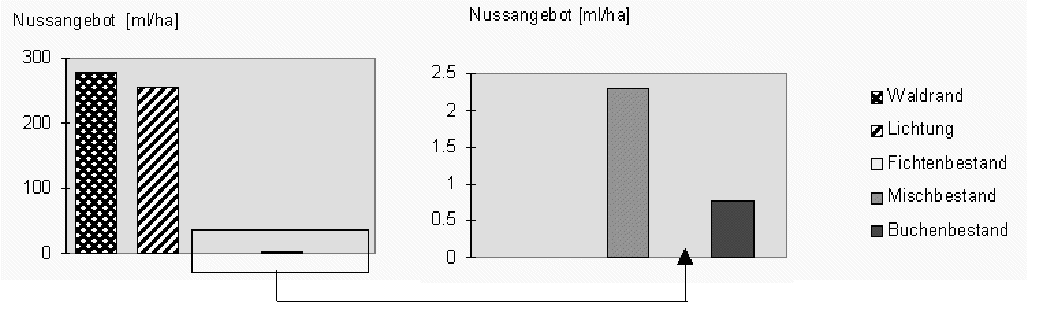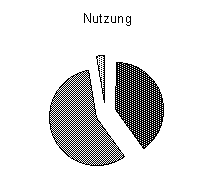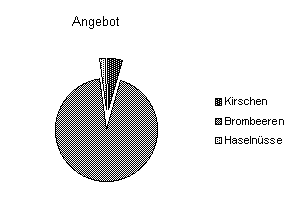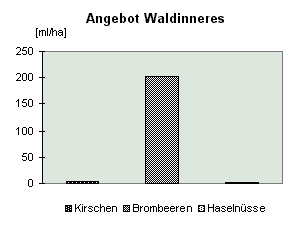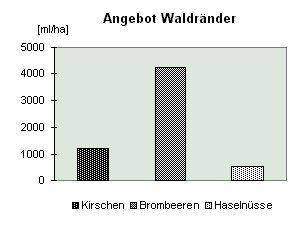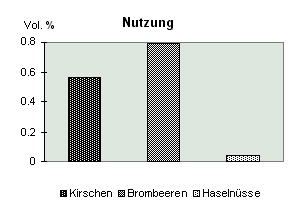3 ERGEBNISSE
3.1 Nutzung
3.1.1 Gesamtnahrung
1-Regenwürmer
2-Insekten
3-Schnecken
4-Wirbeltiere
5-Kirschen
6-Zwetschgen und Aepfel
7-Beeren
8-Getreide
9-Nüsse
10-Pilze
11-Gras
Abb. 2 Zusammensetzung der Dachsnahrung im Sihlwald
(n=88)
Das Nahrungsspektrum der Dachse im Sihlwald ist sehr breit und
umfasst sowohl tierische als auch pflanzliche Komponenten. Es bestätigt die
omnivore Ernährungsweise dieser Tierart mit einer sehr starken
Präferenz für Regenwürmer (
Lumbricidae). Diese Komponente
stellt mit 78,3% des Gesamtvolumens der aufgenommenen Nahrung den Hauptanteil in
der Nahrung der Dachse im Sihlwald dar
[2].
Anteilmäßig der wichtigste Nahrungstyp neben den Regenwürmern
sind die Wirbeltiere (
Vertebrata) (9,5% des Gesamtvolumens). In erster
Linie setzt sich diese Komponente aus Mäusen zusammen und ganz vereinzelt
aus Vögeln oder Aas (MINDER in Vorb.). Insekten (
Insecta) konnten
über den gesamten Untersuchungszeitraum mit hoher Frequenz (70,5%) in der
Dachsnahrung nachgewiesen werden. Ihr Volumenanteil ist aber mit 1,9% der
Gesamtnahrung gering. Weit weniger häufig werden Schnecken
(
Gastropoda), v.a. Nacktschnecken aufgenommen (MINDER in Vorb.). Ihr
Volumen ist mit 3,2% allerdings fast doppelt so gross wie jenes der Insekten.
Die pflanzliche Nahrung macht im Sihlwald mit 7,0% des
Gesamtvolumens einen sehr geringen Anteil in der Dachsnahrung aus: Einzig
Zwetschgen (
Prunus domestica) (2,7%) und Aepfel (
Malus sp.) (1,5%)
kommen in grösseren Mengen vor
[3]. Ihre
Bedeutung wird dann ersichtlich, wenn man den Anteil dieser Nahrungskomponenten
in den ‘positiven’ Proben betrachtet, d.h. jenen, mit Resten dieser
Früchte (Abb. 3, S.15). Die ermittelten Werte von 94,7% (Zwetschgen) und
42,1% (Aepfel) zeigen, dass diese Früchte zur Zeit ihrer Verfügbarkeit
vermutlich in grosser Menge gefressen wurden (Stichprobenanzahlen sind sehr
gering). Als restliche pflanzliche Nahrung konnten Kirschen (0,6%), Beeren
(0,8%), Nüsse (0,1%), Getreide (0,8%) und Pilze (0,1%) ermittelt werden.
Bei den Kirschen (
Prunus avium) ist neben dem geringen Volumenanteil auch
die Frequenz (8,0%) tief, da die Verfügbarkeit auf wenige Monate
beschränkt ist (Abb 2). Den Hauptanteil der aufgenommenen Beeren machen die
Brombeeren (
Rubus fruticosus) aus. Das Volumen der Himbeeren (
Rubus
idaeus) ist sehr gering. Die längere Verfügbarkeitsdauer bei den
Beeren im Gegensatz zu den Kirschen führt zu einer grös-seren Frequenz
(17,1%).
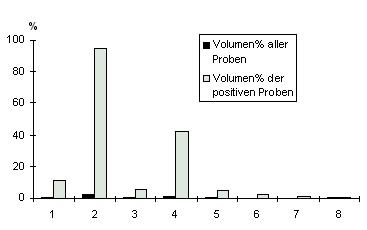
1-Kirschen (positive Proben: n=8)
2-Zwetschgen (positive Proben: n=1)
3-Beeren (positive Proben: n=14)
4-Aepfel (positive Proben: n=3)
5-Getreide (positive Proben: n=19)
6-Nüsse (positive Proben: n=5)
7-Pilze (positive Proben: n=16)
8-Gras (positive Proben: n=80)
Abb. 3 Durchschnittliche
Volumenanteile der einzelnen pflanzlichen Nahrungskategorien in allen
Proben (n=88) und in den positiven Proben des Sihlwaldes
Das Getreide (0,8%), welches in erster Linie Mais (Zea
mays) und nur in unbedeutenden Mengen Weizen (Triticum aestivum)
(0,01%) beinhaltet, wird auch während der Reifezeit kaum genutzt (positive
Proben: 4,7%). Die Auftretensfrequenz (21,5%) ist mit jener der Pilze (18,2%)
vergleichbar. Letztere Nahrungskomponente beinhaltet nur hypogäische Pilze
(Hauptanteil: Hirschtrüffel (Elaphomyces sp.), ausserdem
Schleimtrüffel (Melanogaster sp.) und weitere unbestimmbare,
hypogäische Pilze) und tritt ebenfalls nur in geringen Mengen (0,1%) auf.
Nüsse (v.a. Haselnüsse) konnten nur viermal nachgewiesen werden und
ihr Anteil ist mit 0,06% dementsprechend verschwindend gering. Obwohl Gras die
grösste Frequenz aufweist und praktisch in allen Koten vorkommt (89,8%),
ist es mengenmässig unbedeutend (0,6%).
3.1.2 Saisonale Unterschiede
Abb. 4 Zusammensetzung der Dachsnahrung im
Jahresverlauf (n=88)
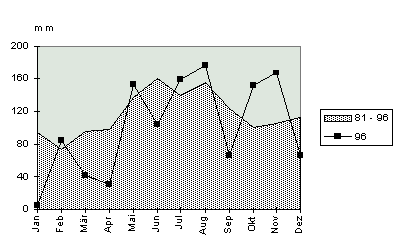
Die Dachsnahrung im Sihlwald zeigt einen deutlichen Jahresgang
(Abb. 4). Mit Ausnahme von Januar und Februar
[4]
ist die Anzahl gefressener Regenwürmer im Winter und Frühjahr
höher als in den Sommer- und Herbstmonaten (Juni-Oktober) (Mann-Whitney
U-Test, P=0.01, n=82). Der Abfall der Regenwürmer während der
Sommermonate ist sowohl in der Frequenz als auch im Anteil am Gesamtvolumen
deutlich sichtbar (Abb. 6). Trotz dieses Rückganges in der Bedeutung ist
diese Beute immer mit über 35 % am Gesamtvolumen vertreten, was auf die
grundlegende Bedeutung der Regenwürmer in der Dachsnahrung hindeutet.
Verbunden mit dem Rückgang der Regenwürmer ist im Frühsommer
(Mai-Juli) ein Anstieg des Anteils der Wirbeltiere. Die hohen Frequenzen der
tierischen Alternativnahrung im November sind auf die geringe Stichprobenzahl
(n=2) zurückzuführen. Das gehäufte Auftreten der Schnecken in den
Monaten Juli und August ist vermutlich mit den hohen Niederschlagsmengen in
jenen Monaten zu erklären (Abb. 5). Die Insekten treten zwar übers
ganze Jahr in den Kotproben auf, ihr mengenmässiges Vorkommen ist aber
gering (Abb 6).
Abb. 5 Vergleich der Niederschlagsmengen der
Zeitperiode 1981-96 mit jenen aus dem Jahre 1996
Die Alternativnahrung zu den Regenwürmern wird im Herbst
praktisch vollständig von Früchten dominiert (Abb. 4). Die ersten
Früchte (Kirschen) treten bereits im Juli in der Dachsnahrung in
Erscheinung (Abb. 7). Da das Kirschenangebot rasch wieder verschwindet, lassen
sich bereits im August praktisch keine Kirschen mehr in den Koten finden. Einen
ähnlichen, nur zeitverschobenen Verlauf wie die Kirschen zeigen die Aepfel
und Zwetschgen. Beide Nahrungstypen konnten zur Reifezeit allerdings nur in
einer Probe nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu den zeitlich sehr
beschränkt verfügbaren Früchten treten die Bombeeren über
längere Zeit (Juli-November) in der Dachsnahrung auf. Ihr
mengenmässiges Vorkommen ist jedoch gering (Abb. 7). Auch die Nüsse
sind über eine längere Zeitspanne für den Dachs verfügbar
und werden dementsprechend auch bis in den Januar hinein genutzt. Das Getreide,
die Pilze und das Gras zeigen keine Saisonalität (Abb. 7). Diese
Nahrungskomponenten kommen zwar übers ganze Jahr relativ häufig vor
(Gras kommt praktisch in jeder Kotprobe vor), machen mengenmässig aber
einen verschwindenden Anteil an der Gesamtnahrung aus. Beim Gras handelt es sich
wahrscheinlich um eine unabsichtliche Aufnahme beim Fressen von
Regenwürmern. Ein Zusammenhang zwischen der Grasmenge und der Anzahl
aufgenommener Regenwürmer konnte allerdings nicht bestätigt werden
(Spearman-Korrelation: -0.035, n=88).
FREQUENZ VOLUMEN
Regenwürmer
Insekten
Schnecken
Wirbeltiere
Pflanzliches Material (ohne Gras)
Abb. 6 Auftreten der wichtigsten Beutekategorien
in den Koten (n=82) im Jahresverlauf
FREQUENZ VOLUMEN
Kirschen
Zwetschgen
Aepfel
Beeren
FREQUENZ VOLUMEN
Nüsse
Getreide
Pilze
Gras
Abb. 7 Auftreten der einzelnen pflanzlichen
Beutekategorien in den Koten (n=82) im Jahresverlauf. Die kleinere Skalierung
der Achsen gegenüber jener in Abb.4 (ausser beim Gras), ist beim direkten
Vergleich mit der tierischen Nahrung in Betracht zu ziehen.
Die Vielfalt des Speisezettels der Dachse (Abb. 8) nimmt gegen
den Herbst hin zu und geht dann im November rasch wieder zurück. In den
Sommer- und Herbstmonaten (Juli-Oktober) ist diese Vielfalt in erster Linie auf
die pflanzlichen Nahrungskategorien zurückzuführen, welche in diesen
Monaten in signifikant grösseren Mengen auftreten als in den übrigen
Monaten (Anova: P=0.035, n=82).
Abb. 8 Anzahl genutzter Nahrungskategorien (in n=82
Koten) im Jahresverlauf
Neben den besprochenen Nahrungstypen traten in den Koten
übers ganze Jahr hinweg verschiedene Samen von Bäumen, Sträuchern
und Kräutern auf (s. Anhang 4, S.41). Den Hauptanteil bei den Baumsamen
machten die Fichtensamen (Picea excelsa) aus. Bucheckern (Fagus
silvatica) wurden nur vereinzelt, z.T. aber mit dem verholzten Fruchtbecher
gefunden. Alle übrigen Baumsamen konnten nur einmal pro Jahr, meistens
jedoch in verschwindenden Anzahlen nachgewiesen werden. Das jahreszeitliche
Muster der Samenverteilung folgt denn auch in erster Linie demjenigen der
Fichtensamen, welche im Mai/Juni anzahlmässig am stärks-ten vertreten
sind (Abb. 9).
Abb. 9 Totale Anzahl gefundener Baum-
und Strauchsamen in 88 Kotproben im Jahresverlauf
Die Strauchsamen stammen von zwei im Sihlwald häufig
vorkommenden Sträuchern, deren Beeren je ca. 2-3 Samen enthalten: der roten
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) und dem Holunder (Sambucus
sp.). Bei letztgenannter Art war eine Bestimmung auf Artniveau nicht
möglich, da die Samen des roten und schwarzen Holunders praktisch identisch
sind.
Die Anzahl der gefundenen Strauchsamen in den Koten weist
einen praktisch identischen Jahresverlauf wie derjenige der Baumsamen auf (Abb.
9). Auch hier wurden die grössten Anzahlen im Mai und Juni
gefunden.
Die in den Koten gefundenen Krautsamen stammen von
verschiedensten Pflanzenfamilien, beinhalten allerdings nur wild vorkommende
Arten. Soweit möglich wurde bis auf Gattungs- bzw. Artniveau bestimmt (s.
Anhang 4, S.41). Aufgrund des Blütenstandes, welcher insbesondere bei
vielen Arten der Poaceaen und Cruciferen, als auch bei der Gattung der
Ranunculaceaen und dem Löwenzahn (Taraxacum officinale) sehr viele
Samen nahe beieinander vereinigt, treten z.T. grosse Anzahlen in den Koten auf.
Das jahreszeitliche Muster der Anzahl der Krautsamen folgt auch hier den in der
Samenzahl dominierenden Familien bzw. Gattungen oder Arten (Abb. 10).
Abb. 10 Totale Anzahl Krautsamen in 88 Koten im
Jahresverlauf
Aus energetischer Sicht scheinen die Monate nach der
Winterruhe eine grosse Bedeutung für die Dachse zu haben (Abb. 11).
Einerseits müssen die aufgebrauchten Fettreserven wieder aufgefüllt
werden und andererseits wird für die Hauptpaarungszeit im Frühjahr ein
erhöhter Energiebedarf benötigt (ZINGG 1995). Im Sommer, zur Zeit der
grössten Nutzung alternativer Nahrung, sinkt der Energiegehalt der Kote auf
rund 25% der April-Werte ab. Bevor die Dachse dann erneut zur Winterruhe
übergehen, werden Fettreserven angelegt, was am Anstieg des Energiegehaltes
auf rund das Doppelte der Juli-Werte sichtbar ist (s. Anhang 7, S.44).
Abb. 11 Durchschnittliche Energiegehalte
der aufgenommenen Nahrung im Jahresverlauf (n=88)
Angebot
Kirschen (Prunus avium)
Brombeeren (Rubus fruticosus)
Haselnüsse (Coryllus avellana)
Abb. 12 Kirschen-, Brombeeren- und Haselnussangebot
[ml/ha] in den untersuchten Beständen
Das Angebot der untersuchten Nahrungstypen (gemessen in ml pro
Hektare) ist an Lichtungs- bzw. Waldrändern am höchsten (Abb. 12).
Neben der erhöhten Anzahl Kirschbäume, Brombeerstauden bzw.
Haselsträucher an den Wald- und Lichtungsrändern trägt auch die
signifikant grössere Anzahl Früchte, Beeren bzw. Nüsse pro Baum
oder Strauch zum erhöhten Angebot gegenüber dem Waldesinnern bei
(Mann-Whitney U-Test: P=0.008, n=18 (Kirschen); P=0.008, n=40 (Brombeeren);
P=0.048, n=24 (Haselnüsse)). Kirschen und Brombeeren weisen auf den
Lichtungen ein rund doppelt so grosses Angebot pro Hektare auf wie am Waldrand.
Im Gegensatz dazu tritt bei den Haselnüssen am Waldrand ein fast ebenso
grosses Angebot pro Hektare auf wie auf den Lichtungen (Abb. 12). Von den
untersuchten Beständen im Waldesinnern weisen die Mischwaldbestände
bei den Kirschen und Haselnüssen das grösste Angebot auf. Der
Fichtenbestand, in welchem Kirschen und Nüsse vollständig fehlen,
stellt dafür das grösste Brombeerenangebot zur Verfügung (mehr
als die Hälfte des Gesamtbrombeerenangebots im Waldinnern).
Hypogäische Pilze
Trotz intensiver Suche konnte einzig in einem Mischwaldbestand
eine Gruppe von 4 Pilzen gefunden werden. Es erfolgten keine weiteren
Analysen.
3.3 Vergleich Nutzung und Angebot
Ein absoluter Vergleich
[5] des
Nahrungsangebots mit der Nutzung war nicht möglich, da einerseits nicht
alle Latrinen bekannt sind und andererseits die analysierten Kotproben nur eine
Stichprobe darstellen. Deshalb können hier nur relative Angaben zu den
einzelnen Nahrungstypen gemacht werden, d.h. es findet immer eine Betrachtung im
Verhältnis zu den anderen Nahrungstypen statt. In Abb. 13 ist einerseits
das Verhältnis aus dem untersuchten, pflanzlichen
Angebot
[6] dargestellt und andererseits wird
dieses demjenigen aus den Koten gegenübergestellt. Auf einen statistischen
Vergleich der Nutzung mit dem Angebot wurde verzichtet, da die Resultate des
genutzten Nahrungsspektrums aus dem Jahre 1996 stammen und die
Angebotsbestimmungen 1997 durchgeführt wurden.
Abb. 13 Nutzung [Vol.%] (n=88) und Angebot [ml/ha] der
Kirschen, Brombeeren und Haselnüsse übers Jahr
Da die Reifezeiten der untersuchten Nahrungstypen nicht
übereinstimmen (Kirschen sind bereits im Juli reif), wurde das
Nutzungs-Verhältnis der untersuchten drei Nahrungskategorien übers
ganze Jahr betrachtet. Dabei ist aber zu beachten, dass sich die dargestellten
Verhältnisse beim Angebot auf Momentaufnahmen zur Zeit der grössten
Verfügbarkeit beziehen und demgegenüber die Verhältnisse der
Nutzung auf der aufgenommenen Menge übers ganze Jahr beruhen. Das heisst,
dass die über längere Zeit verfügbaren Brombeeren und
Haselnüsse bei der Nutzung stark überrepräsentiert sind
gegenüber den Kirschen, deren Reifezeit nur gut einen Monat dauert. Dennoch
ist ersichtlich, dass die Kirschen im Verhältnis zu den Brombeeren und
Haselnüssen überproportional gefressen werden, wenn sie verfügbar
sind.
Abb. 14 Gegenüberstellung der Angebotsmengen
vom Waldinnern bzw. Waldrändern mit der jährlichen Nutzung (n=88)
durch die Dachse
Wald- und Lichtungsränder weisen ein ähnlicheres
Angebotsverhältnis im Vergleich zur Nutzung auf als das Waldinnere (Abb.
14)
[7]. Dies deutet darauf hin, dass die Dachse
die dargestellten Nahrungstypen in erster Linie an Wald- bzw.
Lichtungsrändern erbeuten. Eine erhöhte Benutzungsfrequenz der
Latrinen am Waldrand zur Reifezeit der Früchte (Juli-Oktober) konnte nicht
bestätigt werden (T-Test, P=0.538, n=88). Auch eine spezielle
Zusammensetzung der Kote der Waldrand-Latrinen (<100 m davon entfernt),
welche auf ein Koten kurz vor oder nach der Nahrungssuche hingedeutet
hätten, konnte nicht bestätigt werden (T-Test für die einzelnen
Nahrungskategorien: Regenwürmer P=0.459, n=70; Insekten P=0.123, n=62;
Schnecken P=0.117, n=33; Wirbeltiere P=0.052, n=26; Kirschen P=0.304, n=7;
Zwetschgen & Aepfel, P=0.363, n=4; Beeren P=0.467, n=18; Getreide P=0.671,
n=19; Pilze P=0.734, n=18; Gras P=0.304, n=76).
[2]Die genauen Zahlenwerte der
Nahrungszusammensetzung sind in Anhang 3 (S.41) zusammengestellt.
[3]Zwetschgen und Aepfel wurden
aufgrund des ähnlichen Reifezeitpunktes zusammen dargestellt.
[4]Die Ergebnisse von Januar
und Februar sind wegen der geringen Stichprobenzahl (n=6, wobei je 3 Proben aus
derselben Latrine stammten) und des verminderten Stoffwechsels zu dieser
Jahreszeit wenig aussagekräftig und werden in den folgenden Abbildungen zur
Nahrungsnutzung nicht mehr dargestellt.
[5]Absolut bezieht sich auf die
tatsächlich von den im Sihlwald lebenden Dachsen gefressene
Menge.
[6]Das dargestellte Angebot
bezieht sich auf den ganzen Sihlwald (s. Anhang 8, S.45)
[7]Beim direkten Vergleich der
Angebotsmengen des Waldinneren mit denjenigen der Waldrändern ist auf die
unterschiedliche Skala zu achten.